Über die Zwiefachen und das Miteinander oder: Eine kurze Geschichte des menschlichen Ur-Leidens, dass wir nicht wir sind. [1]
Im heimischen Haine liegt unter ausladenden Obstbäumen, den Strohhut tief in das wettergegerbte Gesicht gezogen … daneben ruht sein knorriger Hirtenstab im kniehohen Grase. Durch die Zweige und die krummen Äste, durch die schimmernden Blätter und das Rascheln in der Baumkrone dringt sanft die Abendsonne und umspielt mit rötlichem Schimmer … streckt seine Hand zur Seite, und pflückt von den tieferhängenden Ästen die süßen Früchte, nach denen … sich so sehr sehnt. Einmal gekostet vom Baum der Erkenntnis gibt es kein Zurück mehr; der Mensch erkennt die Bedingungen der Möglichkeit seiner Existenz: er erkennt, dass er splitternackt ist (vom Strohhute einmal abgesehen). [2] Der Mensch ist in der Lage, sich selbst mit dem eigenen Selbst zu konfrontieren. Selbsterkenntnis bedeutet: Der Mensch ist, einem morschen Holzscheite gleich, gespalten von der Axt seiner eigenen Erkenntnis. Kein geringes Problem, so möchte man meinen, was wir uns da eingehandelt haben. „Mensch, wo bist du?“ [3] lautet daraufhin im Alten Testament die Frage Gottes, als der in Furcht geratene Erdling sich im Garten Eden versteckt hat. Nachdem das eigene Ich kurzerhand in zwei Teile gerissen wurde, ist diese Frage tatsächlich nicht mehr so leicht zu beantworten: Wo bin ich eigentlich? Befinde ich mich hier, formuliere Sätze und tippe im Abendlicht auf meiner Tastatur herum? Oder bin ich dort, folge meinen Gedanken und höre mir selbst zu beim Tippen und Formulieren?
Oh Muse, lehre mich, wie du die Sache siehst, und mit welcher Kunst ich die Spaltung meines Herzens zu beherrschen in der Lage bin! Welcher Ort mag es sein, an dem der Mensch seine innere Zerrissenheit überwindet? Wo wird der Mensch wieder die Einheit, die er einmal war? Muss er dazu sein geteiltes Wesen und die damit verbundene Selbsterkenntnis aufgeben?
Der innere Dialog des geteilten Menschen
Wenden wir unsere Aufmerksamkeit (die ungeteilte) nun der ur-philosophischen Gestalt des Sokrates zu. Warum? Weil am möglicherweise strohhuttragenden Sokrates und dessen durch die Tradition auf uns gekommenen Gesprächen deutlich wird, wie menschliche Selbsterkenntnis zu einer dauerhaften Lebensform wurde. Hannah Arendt als gute Freundin des Strokrates wird uns in diesem Bemühen wacker zur Seite stehen:
„Selbst wenn ich ganz allein leben würde, so lebte ich doch mein Leben lang im Zustand der Pluralität.“ [4] Hannah Arendt betrachtet den Menschen in seiner Einsamkeit – er hat sich entfernt von der Gesellschaft und zurückgezogen in seine ruhige Kammer. Doch sind wir in so einem Moment wirklich allein? Nein, würde Arendt sagen, denn: „Ich muss mit mir selber zurechtkommen, und nirgendwo zeigt sich dieses Ich-mit-mir deutlicher als im abstrakten Denken, das immer ein Dialog in der Gespaltenheit, zwischen den Zweien-in-Einem ist.“ [5]
Die Gespaltenheit meines Ichs steht nun nicht mehr als furchteinflößendes Ereignis oder nackte Tatsache im Raum, sondern hat sich zu einem Dialog ausgeformt. Dieses innere Gespräch als Fundament des Denkens begründet zu haben, sieht Arendt als eine wesentliche Leistung des Sokrates an. [6] Der Dialog mit mir selbst ist sozusagen die in die Zeit verlängerte Selbsterkenntnis. Der heutzutage übliche Begriff „Individuum“ („Unteilbares“) muss in sein Gegenteil verkehrt werden! Der Mensch ist nicht unteilbar, er ist teilbar; er ist geteilt in sich und sich! Er ist auch keine Sache, was die neutrale Form „das Individuum“ jedoch suggeriert, sondern er ist Person. Wir wollen daher von „der Dividuus*die Dividua“ sprechen. (Wir hoffen, mit diesem Neologismus nicht auf dieselbe verständnislose Ablehnung zu treffen, die manch anderem bei derartigen Wortkreationen gelegentlich entgegengebracht wird.) Die Erkenntnis, dass wir Dividui*ae [7] gerade im Moment der Einsamkeit sind – das auf den Einzelnen angewendete „I know, I’m not alone“ – birgt in unserem Zeitalter eine wichtige Herausforderung. Denn unsere Kammern, unsere Wohnstuben oder Schlafgemächer, sind schon länger nicht mehr die Orte des ruhigen Rückzuges, die sie einmal waren. Fernab von einer polemischen Schelte der technischen Revolution ist es bemerkenswert, dass wir uns die Zeit unserer Einsamkeit und privaten Abgeschiedenheit, unseres Daseins mit uns selbst als Dividui*ae, bewusster und ausdrücklicher nehmen müssen, wenn die ganze Welt auf Knopfdruck erreichbar scheint. Wenn die innere Pluralität des „Ich spreche und Ich höre mir zu“ sich wandelt zu „Die mediale Welt spricht und ich höre zu“, dann gewinnt der Mensch durch die Technik nicht eine Welt, sondern verfehlt gerade seine ihm innerliche Welt und sein Mit-sich-befreundet-Sein. Wenn der Mensch sein Leben vollständig durch Push-up-Benachrichtigungen und You-Tube-Videos bestimmt sein ließe, würde er seine Seele dabei verlieren. Er gäbe die innere Pluralität auf – die Voraussetzung seines Denkens. [8] Nicht nur die Möglichkeiten des modernen Menschen sind durch die technische Revolution um ein Vielfaches gewachsen, sondern auch seine Herausforderungen!
Menschliche Existenz vollzieht sich im Modus der Pluralität. Im Dialog mit sich selbst befindet sich der Mensch im Zustand der inneren Pluralität. In die äußere Pluralität tritt ein, wer sich wie Sokrates auf den Marktplatz stellt und mit seinen Mitmenschen zu diskutieren anfängt. Menschliches Leben ist plurales Leben – in innerlicher wie äußerlicher Hinsicht? Was ist aus dem Wunsch nach der inneren Einheit des Menschen geworden? Hatte unser Mensch sich nicht danach gesehnt, die innere Zerrissenheit zu überwinden? Arendt hat einen Vorschlag, um den Geteilten wieder zum Einssein zurückzuführen: „[Es ist] das Gespräch mit anderen, das mich aus dem aufspaltenden Gespräch mit mir selbst herausreißt und mich wieder zu einem macht – zu einem einzigen, einzigartigen Menschen, der nur mit einer Stimme spricht und von allen als ein einziger Mensch erkannt wird.“ [9]
Einheit und Gespaltenheit im menschlichen Miteinander
In dem Augenblick, da der Mensch eintritt in ein lebendiges Miteinander, in einen Dialog mit anderen, wird er zu einem. Ein Mensch betrachtet einen anderen stets als einen anderen, der mit einem Namen gerufen werden kann. Der andere Mensch tritt im Miteinander gewissermaßen an die Stelle desjenigen Gegenübers, das ich mir im inneren Dialog selbst bin. Der eine Mensch ist nicht mehr zugleich sprechender und zuhörender, sondern der Mensch im Miteinander ist entweder sprechender oder zuhörender. In ähnlichen Formen, in denen der Mensch zu sich selbst spricht, wird er auch zu anderen sprechen; und auf vergleichbare Weise, auf die er anderen zuhört, wird er auch sich selbst zuhören. Da sich jede*r anders zu sich selbst verhält, unterscheiden wir uns alle auch im sozialen Umgang – so erwächst aus unserer inneren Pluralität die äußere Vielfalt der Menschheit. [10] Und zugleich bildet sich diese äußere Pluralität in jener inneren ab. Das Loblied auf die äußere Pluralität und die damit verbundenen Möglichkeiten überspringe ich an dieser Stelle und verweise exemplarisch auf die beeindruckende Vielfalt der Beiträge in dieser Ausgabe der FUNZEL (einfach vor oder zurückblättern).
Aus seinem Umgang mit sich entstehen dem Menschen auch Erwartungen anderen gegenüber. Dazu kann z. B. auch eine Offenheit in der eigenen Erwartung gegenüber dem Unbekannten gehören. Was jedoch, wenn es trotz Offenheit auf beiden Seiten zum Konflikt kommt? Wenn die Bereitschaft zur Toleranz an ihre Grenzen stößt? Wenn der andere in einer derartigen Weise meinen Erwartungen an ein Miteinander widerspricht, dass ich dagegen aufbegehren muss? Menschliche Pluralität hat Konfliktpotential. Auf dem Marktplatz geht es auch schon mal hoch her. Im Eifer des Gefechts oder bedingt durch die situative Kürze der Zeit können Missverständnisse entstehen. Enttäuschte Erwartungen, die nicht artikuliert werden, können zerstörerisch in der Seele des Menschen wirken und zum Rückschlag oder Rückzug reizen. Wie können die Menschen zu einem Miteinander gelangen, das nicht in einen Kampf des „Jeder gegen Jeden“ kollabiert? Wie kann eine Gesellschaft es vermeiden, zu einer grölenden Schar zu degenerieren, in der das Recht des Stärkeren (ob durchgesetzt in der Politik oder im direkten Gegenüber) das einzige leitende Ideal ist und wo der Mensch sich dauerhaft in Kampfbereitschaft befindet? Wie kann es geschehen, dass nicht „Durchsetzung“ der tragende Habitus der menschlichen Person wird sondern „Miteinander“? [11]
Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber äußerte im Jahr 1930 auf der Tagung des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Deutschlands in München folgenden Gedanken: „Wenn Menschen miteinander wirklich etwas zu tun haben, miteinander erfahren und miteinander auf diese Erfahrung lebensmäßig antworten, wenn Menschen eine lebendige Mitte haben, um die sie gereiht sind, dann entsteht Gemeinschaft zwischen ihnen. […] Nicht durch die Kreisziehung, sondern durch die Radienziehung entsteht Gemeinschaft.“ [12]
Ein Miteinander entsteht demzufolge weder durch das Ziehen von Grenzen noch bereits durch deren Öffnung; Miteinander entsteht durch gelebten Bezug zur Mitte. Das bedeutet auch: Allein vom Einzelnen her, vom Dividus und von der Dividua her, lässt sich ein Miteinander verwirklichen. Jede*r Dividuus*a trägt somit die volle Verantwortung für ein erfolgreiches Zusammenleben. Das Leben gleicht einer Partie Poker und um in ein wahrhaftes Miteinander einzutreten, müssen wir bloß alle gleichzeitig all-in gehen. Nur wenn die ganze Existenz eingesetzt wird, kann auch das ganze Miteinander gewonnen werden. [13]
Um bei einem derart heißen Poker nicht die Nerven zu verlieren, scheint es geboten, sich gelegentlich in den inneren Dialog zurückziehen und sich mit sich selbst zu beratschlagen. Nur wenn neben der äußeren Casino-Pluralität auch die innere Dialog-Pluralität ihr Recht behält, kann der Mensch immer wieder all-in gehen und sich mit ganz ungeteiltem Herzen in die Gesellschaft einbringen. Nur in der Spannung von Einsamkeit und Mehrsamkeit, von innerem und äußerem Dialog, ist der Mensch in jeder Hinsicht präsent und nur so kann er sich als ganzer auf das Wagnis eines wahrhaften Miteinanders einlassen, nur so geht er ohne Chips in der Hinterhand all-in und verwirklicht seinen Radius, d. i. seinen Bezug zur Mitte des Miteinanders.
Doch bevor man auf die Idee kommt, nun mit wehenden Fahnen übereifrig das ideale Miteinander durch staatliche Institutionen, Verhaltensnormen und Gesetze einrichten zu wollen, mahnt Buber: „Ebensowenig wie man Persönlichkeit herstellen kann, kann man Gemeinschaft herstellen; diese hohen Werte entstehen nur als Nebenprodukt.“ [14]
Das Miteinander kann nicht aus unserer eigenen Kraft hervorgebracht, nicht einmal angemessen gewollt werden. [15] Die Mitte, um die ein wahrhaftes Miteinander herum sich gruppiert, ist nichts, was die Dividui*ae selbst herzustellen in der Lage wären. Sie manifestiert sich in ereignishaftem Charakter und geht dem Verhältnis des Menschen zu ihr immer schon einen Schritt voran. [16] Wir haben Anteil an der Mitte des Miteinanders. Das bedeutet, dass wir unsere kulturelle Vorprägung, die uns durch dieses Anteilsverhältnis mitgegeben wurde, immer wieder neu entdecken dürfen. Der Mensch ist auch ein sozial und geschichtlich konstruiertes Wesen und damit umzugehen ist eine der schönen und schwierigen und zugleich wundersamen Aufgaben menschlicher Existenz. Die Gesellschaft und die Geschichte – beide sind eine Schatztruhe, die der Mensch in seinem Leben immer wieder neu öffnen und durchsuchen darf: „Oh, sieh mal, hier, ein Gerechtigkeitsbegriff in der Tradition Platons, wie beeindruckend!“ – „Toll! Welche Rarität! Heutzutage vermutlich nur noch antiquarisch erhältlich! Und schau dir das an: Ein Gedanke hinsichtlich der Vielfalt der Kulturen, den mag ich mir auf den Kaminsims stellen.“ Menschliche Freiheit verwirklicht sich nicht in der Loslösung von der kulturellen Vorprägung menschlicher Existenz, sondern in deren durchahnender Entdeckung, in der Fähigkeit zum Umgang mit ihr und in der (eigenständig vollzogenen) Verwirklichung von Kultur im eigenen Ich. Der*Die Einzelne, vorgestellt als Dividuus*a, lebt aus der ihm vom Miteinander her geschenkten Kultur heraus, gerade weil er*sie Zwei-in Einem*r ist. Meine innere Pluralität, die Fähigkeit des „Mich-mir-Gegenüberstellens“, sowie das Bild, das ich mir dabei von meiner Person mache – all das ereignet sich nicht in einem menschenleeren Universum, sondern im Kosmos des menschlichen Miteinanders.
Somit gilt nicht nur: Das Miteinander erwächst und lebt aus und in den Dividui*ae. Sondern es muss ebenso bedacht werden: Die Dividui*ae erwachsen und leben in und aus dem Miteinander. [17] Deshalb ist es nicht gut, dass der Mensch allein unterm Obstbaum liege. [18]
[1] Dieser Text versucht philosophisch und allein mit den Mitteln der Vernunft zu argumentieren. Es soll jedoch keineswegs verhehlt werden, dass viele Ideen aus der theologischen Literatur stammen. Die Adaption dieser Gedanken in einen neuen Kontext erhebt weder den Anspruch, die religiösen Gehalte vollständig zu erfassen und zu übersetzen, noch möchte sie die philosophische Vernunft mit wesensfremden Argumentationsmustern unterwandern – die Adaption dieser Gedanken möchte Denken auf der Suche nach begründeter Erkenntnis sein. Ob dieses Vorhaben gelungen ist, möge der*die Leser*in selbst entscheiden.
[2] Vgl. GENESIS 3,7.
[3] Vgl. GENESIS 3,9.
[4] ARENDT, Hannah: Sokrates. Apologie der Pluralität, Berlin 2016, 57.
[5] ARENDT, 57.
[6] Vgl. ARENDT, 61f.
[7] Die Form „Dividui*ae“ ist der Plural des Singulars „Dividuus*a“.
[8] Vgl. ARENDT, 63.
[9] ARENDT 57.
[10] Vgl. ARENDT, 85, u.a.
[11] BUBER, Martin: Wie kann Gemeinschaft werden? Auf der Tagung des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Deutschlands in München, Juni 1930, gesprochen, in: Ders.: Worte an die Jugend, Berlin 1938, 49.
[12] BUBER, Gemeinschaft, 54f.
[13] Vgl. BUBER, 52.
[14] BUBER, Gemeinschaft, 54.
[15] Vgl. BUBER, Gemeinschaft. 53.
[16] Vgl. BUBER, Gemeinschaft, 57.
[17] Der Gedanke dieses wechselweisen Verhältnisses ist einem Schreiben der Glaubenskongregation in Rom entnommen, in dem es sich jedoch auf das Verhältnis von Gesamtkirche und Teilkirchen bezieht. In freier Aneignung habe ich diesen Gedanken aus seinem ursprünglichen Kontext gelöst und auf das Verhältnis von Miteinander und Einzelnen übertragen. Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre: Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als communio, II. Gesamtkirche und Teilkirchen, Rom, den 28. Mai 1992.
[18] Vgl. dazu GENESIS 2,18 und ARENDT, 85, von der ich die Idee, diesen Bibelvers (in abgewandelter Form) ans Ende einer Betrachtung zu stellen, schamlos abgekupfert habe.
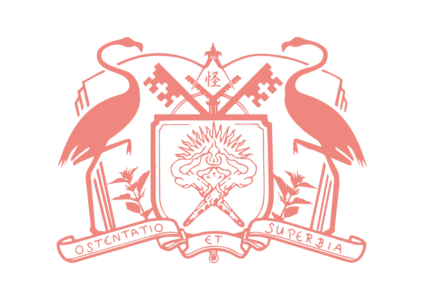
Ein Kommentar zu „De dividuis atque communitate“