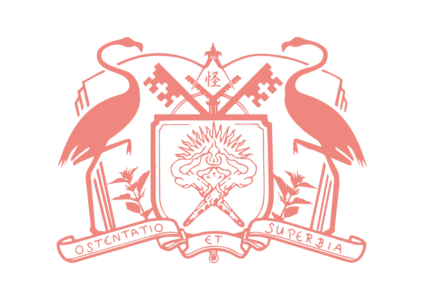Ein Orientierungsversuch mit Konfuzius
Ich weiß nicht so recht, was ich tue. Damit bin ich nicht allein. Gerade die Hörsäle der Geisteswissenschaftler sind angefüllt von Menschen, die, wie ich, zwar lieben, was sie tun, aber doch nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Wo dieser gewählte Weg eigentlich hinführt. Selbstverständlich ist dieses mehr oder weniger blinde Sich-Vortasten auf dem immer unerkennbaren Weg kein universelles Phänomen, und ich gratuliere jeder Person herzlichst, die genau weiß, wo sie steht, es sei denn, sie glaubt dies nur und das Panorama ihres Weges löst sich beim nächsten Zweifelswind in umherfliegende Pixel auf. Doch der Rest von uns kennt sie wohl, diese Orientierungslosigkeit, diese Sinnsuche unter Wellen der Sinnlosigkeit, und diese Arbeit, mit der man sich fast zu Sisyphus in der Unterwelt gesellen möchte. Diesen Versuch des Festhaltens an irgendetwas Bedeutsamem, geschrieben mit den Fingern im Sand, der von den Wellen immer wieder abgetragen wird. Ich möchte hier gewissermaßen den Sand betrachten, auf dem ich stehe, und der mir unter den Füßen immer wieder weggezogen wird. Ich möchte außerdem versuchen, eine mögliche Erklärung dafür zu liefern, wo dieser Sand überhaupt herkommt, und warum ich eigentlich darauf stehe. Schließlich möchte ich aufzeigen, dass man den Weg doch noch finden kann, wenn auch nicht auf die theoretisch und systematisch abgesicherte Weise, wie man es in der Philosophie häufig gerne hätte.
Man könnte den Strand, auf dem sich diese orientierungslose Sinnsuche abspielt, das psychosoziale Moratorium nennen. Geprägt wurde dieser Begriff erstmals von Erik H. Erikson. Er bezeichnet eine Übergangsphase im Prozess des Erwachsenwerdens, einen Aufschub, eine Pause. Die Dauer dieser Phase verlängert sich zunehmend. Immer mehr, immer ältere Menschen schweben durch ihr Leben. Doch warum ist dies der Fall? Meines Erachtens nach liegt die Begründung in unserer heutigen Auffassung und Wertung von Freiheit.
Freiheit bedeutet Ungebundenheit, Unabhängigkeit; Freiheit bedeutet Schwerelosigkeit; Freiheit bedeutet Schweben, losgelöst in der Leere. Dieser Freiheitsbegriff taucht in Platons Phaidon auf, wo das Ziel der Philosophie eigentlich die Befreiung der Seele vom Körper ist, oder auch bei der radikalen Selbstdefinition des Menschen im Existentialismus. Gleichzeitig ist Freiheit einer der höchsten Werte in unserer Gesellschaft. Vom Himmel schallt der Ruf des Weißkopfseeadlers und erinnert uns stets daran, dass wir tun können, was wir nur wollen. Im Zuge dieses Denkmusters haben wir die Sinnsuche erfolgreich normalisiert, und damit vielen Menschen viele neue Wege eröffnet. Die Gefahr liegt nun meines Erachtens in der Glorifizierung dieser Sinnsuche, und in der daraus resultierenden, fast religiös anmutenden Erhebung der Sinnlosigkeit über den Sinn. Denn während es im Radio rauf und runter heißt, “du kannst noch gar nicht wissen, was du willst -”, trägt der Freiheitsbegriff eine Reihe von Implikationen mit sich, unter anderem, dass man seine Freiheit aufgeben müsse, wenn man sich auf einen Weg begibt. Öffnet dieser Freiheitsbegriff in der Fassung, auf den wir ihn zugespitzt haben, überhaupt noch mehr Türen, als er schließt?
Und von wo fange ich eigentlich an zu gehen, wenn ich mich zuallererst als Individuum betrachte, als Wesen in einer kleinen Luftblase, weit entfernt von der Schwerkraft jedes Planeten schwebend? Wie kann ich meinen Weg finden?
“Konfuzius sprach: Während niemand das Haus verlassen kann, ohne durch die Tür zu gehen, wie kann es da sein, dass die Menschen nicht den rechten Weg nehmen?” [1]
Man kennt Konfuzius präzise aus der Ecke der glorifizierten Sinnsuche, von Büchern voller hochmetaphorischer, kontextbefreiter (und daher im Grunde nichtssagender) Lebensweisheiten, und von Teebeutelsprüchen, die morgens am müden Gehirn vorbeiziehen. Ich denke jedoch, Konfuzius kann mehr. Ich möchte hier nicht anfangen, die immensen Überlieferungs- und Übersetzungsschwierigkeiten darzulegen, und ich möchte keineswegs behaupten, nachvollziehen zu können, was genau der historische Konfuzius in China um fünfhundert vor unserer Zeit genau gedacht und gesagt haben mag. Stattdessen möchte ich eine Interpretation umreißen, die ein möglicher erster Schritt in der Überdenkung unseres angeknacksten Freiheitsbegriffes sein könnte.
Kommen wir also zurück auf den Weg, den wir am Anfang schon einmal blind versuchten, zu gehen. Was diesen Weg angeht, stolpern wir heutzutage leicht über eine etablierte Dichotomie zwischen Individuum und Welt, eine Idee, die impliziert, dass der Weg, der bereits ist, nicht meiner sein kann, und der Weg, den ich mir baue, immer im Konflikt mit der Welt stehen wird. Bei Konfuzius hingegen existiert dieser Spalt nicht, der für uns so schwer zu überwinden ist.
Denn: “Denken, ohne etwas gelernt zu haben – das ist verderblich”, findet sich im selben Ausspruch aus den Gesprächen wie “Lernen ohne zu denken – das ist nutzlos.“ [2] Für Konfuzius muss man zunächst aus der Tradition und von anderen lernen, bevor man in ihr denken, über sie reflektieren und sie transformieren kann. Für Konfuzius steht der einzelne Mensch niemals isoliert von der Gemeinschaft und der Welt da.
“Konfuzius sprach: Die Lieder inspirieren den Menschen. Die Riten geben ihm Halt. Die Musik lässt ihn Erfüllung finden.“[3] Nur in Konversation mit der Welt kann man also seinen Weg in ihr finden, und nur so kann man sinnvoll, tiefgehend sein. Der eigene Weg ist nicht ex nihilo zu kreieren, sondern indem man die Wege der Welt verstehen lernt für sich zu transformieren. Dieser Weg ist schwerer als ein Schweben in Schwerelosigkeit. Auf diesem Weg hat man sich selbst zu tragen, und einen schweren Rucksack gleich mit, ein Stück Welt, sowie eine Ladung Verantwortung.
“Schüler können nicht anders, als ausdauernd und mutig zu sein. Ihre Last ist schwer, ihr Weg ist weit. Sich die Tugend der Menschlichkeit als Last aufzunehmen, ist das etwa nicht schwer? Erst der Tod beendet ihr Streben – ist dieser Weg etwa nicht weit?“ [4]
Doch Gewicht ist nicht immer negativ konnotiert zu verstehen. Im Grunde geht es darum, der Welt ihr Gewicht wieder zuzugestehen, ihre Wichtigkeit und Bedeutung, und zugleich an das eigene Gewicht zu glauben, an die eigene Wichtigkeit und die eigene Bedeutung. So erhält man diese Spannung aufrecht, die zwischen dem Verlust seines Gewichtes in der Masse von Welt und dem Sich-Verlieren in seiner eigenen Sicht besteht. In reziproker Bedeutung kann sich dann ein Gleichgewicht finden, und so auch Harmonie. An diesem Streben kann man sich, denke ich, orientieren.
Schließlich sei nur noch gesagt: Um Licht ins Dunkel bringen zu können, braucht man Licht, eine Flamme, ob nun ein Streichholz oder gleich ein Lagerfeuer; man braucht aber auch Dinge, die von diesem Licht beleuchtet werden können. Auch wenn die Fackel manchmal schwer zu tragen ist.
[1] Konfuzius, Gespräche. VI, 17. Die Gespräche werden annähernd zitiert nach: Konfuzius, Gespräche, Moritz, Ralf (Hrsg.), übers. v. ebd., Stuttgart 2017. Ich habe mir, obwohl ich selbst kein Chinesisch kann, erlaubt, diese Übersetzung unter Zuhilfenahme einer weiteren Übersetzung zu modifizieren. Diese ist: The Analects of Confucius (A Philosophical Translation), übers. v. Roger T. Ames u. Henry Rosemont, Jr., New York 1998.
[2] Konfuzius, Gespräche. II, 15.
[3] Konfuzius, Gespräche. VIII, 8.
[4] Konfuzius, Gespräche. VIII, 7.