Eine Buchrezension
Ungewöhnliches zieht natürlicherweise mehr Aufmerksamkeit auf sich als Gewöhnliches. Damit ist aber nicht gesagt, dass Ungewöhnliches auch gleichzeitig gut ist. So ähnlich ist es mit Elias Canetti. Autor und Werk sind vor allem eines: ungewöhnlich. Canetti, 1905 in Bulgarien geboren, 1994 in Zürich gestorben, erlangte erst spät internationale Bekanntheit. Spät und als geschätzter, aber nicht sonderlich bekannter Autor, erhielt er 1981 den Literaturnobelpreis. Von Zeitgenossen wird er einerseits als talentierter Beobachter, als höflicher Gentleman und Sprachgenie, andererseits als arroganter Egoist beschrieben. Marcel Reich-Ranicki soll Canetti einmal gefragt haben, ob er einen kurzen Text über Günter Grass schreiben würde. Canetti entgegnete daraufhin wohl, dass er noch nie etwas von Grass gelesen hätte. Außerdem nahm Canetti keine Auftragsarbeiten an. Und in seinem anthropologischen Hauptwerk „Masse und Macht“, in dem sich Canetti mit dem Massephänomen auseinandersetzt, erwähnt Canetti mit keinem Wort die wichtigsten Theoretiker auf diesem Feld – wie etwa Marx, Nietzsche oder Freud. Man darf natürlich Bücher über das Massephänomen schreiben, ohne Marx, Nitzsche oder Freud zu zitieren. Aber ungewöhnlich ist es trotzdem. Auf Canettis Person werfen außerdem viele Frauengestalten einen Schatten. Allen voran Veza Canetti, seine erste Ehefrau, die die Brötchen verdiente, seine zahlreichen Affären duldete und als Schriftstellerin weitgehend unbekannt blieb. Es ist umstritten, inwiefern Elias Canetti Veza an einer eigenen schriftstellerischen Karriere gehindert hat. Fakt ist, das Veza Canetti erst nach ihrem Tod als Schriftstellerin Aufmerksamkeit erhielt.
Sein frühes Hauptwerk „Die Blendung“, erschien zum ersten Mal 1935 und wurde zu Canettis Lebzeiten mehrmals herausgebracht– jedes Mal mit größerem Erfolg. Es ist Prosa an der Schnittstelle zur Theorie, bzw. theoretische Prosa. Das ist es wahrscheinlich auch, was einen das Werk so schwierig einschätzen lässt.
„Die Blendung“ erzählt keine wirkliche Geschichte. Eher versucht sich Canetti daran, die Verblendetheit verschiedener Menschen durchzuexerzieren – allen voran die des Philologen Peter Kien. Das Buch ist unterteilt in drei Teile: „ein Kopf ohne Welt“, „Kopflose Welt“ und „Welt im Kopf“.
Im ersten Teil beginnt Kiens Unglück. Er, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Sinologie, folgt einem strengen Tagesablauf, lebt abgeschieden und arbeitet fortwährend. Allem „Profanen“ wie Essen, Waschen, soziale Kontakte pflegen, etc. schenkt er keine Beachtung. Er ist sozusagen ein wissensraffender „Kopf“ ohne (Lebens-)„Welt“. Um den Status quo zu konsolidieren, heiratet Kien im Affekt seine Haushälterin Therese. Sie ist die einzige Person, der er das Abstauben seiner Bücher anvertraut, und er möchte Therese durch Heirat an sich binden. Canetti lässt dabei offen, ob Therese ihn verführt hat oder ob es Kiens alleinige Entscheidung war. Kien und Therese sind allerdings nicht imstande, sich aufeinander einzulassen. Ganz im Gegenteil. Je weiter die Handlung fortschreitet, desto stärker verstricken Therese und Kien sich in Konflikten. Denn beide Personen sind von ihren Wünschen und Ängsten so eingenommen, dass grobe Missverständnisse unvermeidbar sind und Kommunikation eigentlich unmöglich wird. Letztendlich wird Therese gewalttätig und wirft Kien aus seinem eigenen Haus.
Im zweiten Teil versucht Kein, seine Bibliothek wiederzubeschaffen. Er trifft dabei in einer zwielichtigen Kneipe auf das vermeintliche Schachgenie „Fischerle“. Er wird Kiens zeitweiser Begleiter. Aber auch diese zwei Personen haben durch ihre Egozentrik eine so verzerrte Wahrnehmung, dass sie nicht miteinander umgehen können. Fischerle unterstellt Kien am Ende böse Absichten und bringt ihn mittels einer List um sein Geld. Der Titel des zweiten Teils „Kopflose Welt“ beschreibt also vor allem, dass Kien sich erst recht nicht auf die wirkliche Welt einlassen kann. Stattdessen sieht er in der Welt einfach nur sein nach außen gekehrtes Inneres, und übersieht dabei die Realität.
Das Buch endet mit dem kürzesten Teil „Welt im Kopf“. In diesem kehrt Kien zu seiner alten Wohnung zurück, in der Therese mittlerweile mit dem Hausmeister das Bett teilt. Davor hat er an seinen Bruder eine Nachricht abgesetzt, er sei „meschugge“. Sein Bruder, ein Psychiater, den Kien seit acht Jahren nicht gesehen hat, eilt nach Wien. Auf nur wenigen Seiten verschafft Georg Kien seinem Bruder seine Wohnung zurück und die Scheidung von Therese. Am Ende bricht ein Feuer aus und Kien verbrennt in dem Feuer mitsamt seiner Bibliothek.
Tja. Das Ungewöhnliche an Canettis Buch ist, dass seine Figuren eigentlich nicht als Menschen, sondern eher als Konzepte angelegt sind. Jede Figur hat kein besonderes Eigenleben, sondern dient der Veranschaulichung eines bestimmten Extrems. Canetti beschreibt seine Figuren als Egozentriker, die dem Leser oder der Leserin immer mit derselben Haltung begegnen. Das sieht man unter anderem daran, dass sich keine Figur in seinem Roman verändert. Canettis Ziel für diese Erzählweise beschreibt Canetti in einem Interview:
„Eines Tages kam mir der Gedanke, daß die Welt nicht mehr so darzustellen war, wie in früheren Romanen, sozusagen vom Standpunkt des Schriftstellers aus. Die Welt war zerfallen, und nur wenn man den Mut hatte, sie in ihrer Zerfallenheit zu zeigen, war es noch möglich, eine wahrhafte Vorstellung von ihr zu geben. Das bedeutete aber nicht, daß man sich an ein chaotisches Buch zu machen hatte, in dem nichts mehr zu verstehen war. Im Gegenteil: man musste mit strengster Konsequenz extreme Individuen erfinden, so wie die, aus denen die Welt ja auch bestand, und diese auf die Spitze getriebenen Individuen in ihrer Geschiedenheit nebeneinanderstellen.“ (Gespräch über den Roman. 1976, 90 f.)
Canettis Figuren sollen also eine präzise Übertreibung dessen sein, was er den meisten seiner Mitmenschen unterstellte: verblendende Egozentrik, die dazu führte, dass man sich nicht mehr so mit der Welt so auseinandersetzen kann, wie diese wirklich ist. Der heraufdämmernde Faschismus muss Canetti sehr stark zu dieser Art von Vorstellung veranlasst haben. Die Frage für ihn ist also nicht, wie man ein authentisches Weltverhältnis aufbaut, sondern was passiert, wenn man es nicht tut.
Im Zuge dessen verhandelt Canetti die Rolle des Intellektuellen. Kien wird als jemand beschrieben, der ein vollkommen reines Verhältnis zum Wissen hat. Sein Ziel ist es einzig und allein, Wissen zu erlangen und neues Wissen zu generieren. Wissen ist für Kien nicht etwas, mit dem man angeben oder das man als Machtinstrument missbrauchen könnte. Deswegen arbeitet Kien zum Beispiel vollkommen zurückgezogen und unterhält sich im Geiste mit den Autoren der Bücher in seiner Bibliothek. Im Laufe des Romans immaterialisieren sich Kiens Bücher sogar. Im zweiten Teil des Buches trägt er seine Bibliothek im Kopf, was eine seltsame Vermischung zwischen Materiellem und Immateriellem nach sich zieht. Fischerle hilft Kien vor dem Einschlafen dabei, die Bücher aus Kiens Kopf auf den Boden zu legen, sodass Kien mit leerem Kopf einschlafen kann. Am Morgen stellen sie alle Bücher wieder in Kiens Kopf. Trotz seines Intellekts und seiner Intelligenz weiß Kien nichts wirklich besser als alle anderen Figuren. Er ist in sich selbst gefangen und berührt die Realität beinahe überhaupt nicht.
Canetti erschafft so einen vollkommenen Gegensatz zwischen einer profanen Alltagswelt, in der zum Beispiel Therese in Möbelhäuser geht und kocht und einer rein intellektuellen Welt, in der Kien Abhandlungen schreibt. Dieser Unterschied besteht auch dann, wenn Kien aus seiner Bibliothek vertrieben wird. Beide Welten – profane und intellektuelle – sind gleichermaßen defizitär, labil und jederzeit einsturzbereit, wenn sie nicht in irgendeiner Weise verbunden werden. Wahrscheinlich ist es auch das, was Canetti mit „Zerfallenheit“ im oben erwähnten Zitat meint: die Fragmentiertheit der Lebenswelten, die kein gesundes Verhältnis zur Wirklichkeit zulassen, sondern an ihrer Abgeschlossenheit irgendwann zu Grunde gehen. So sagt Kien am Ende zu seinem Bruder:
„Eine plötzliche Verkehrung des Sinnreichsten ins Sinnloseste [ist die Liebe]. Es ist – man kann das mit nichts vergleichen, ja, es ist, als ob du dich eines hellichten Tages, bei gesunden Augen und voller Vernunft, mitsamt deinen Büchern in Brand setzen würdest. […] Ich glaube an die Wissenschaft, täglich mehr, und täglich weniger an die Unersetzbarkeit der Liebe!“ (536)
Wenige Seiten später verbrennt Kien, wie erwähnt, in seiner Bibliothek. Ironischerweise stellt sich so genau das ein, was Kien im oben genannten Zitat noch als Metapher für die „plötzliche Verkehrung des Sinnreichsten ins Sinnloseste“ nannte. Er setzt sich selbst am helllichten Tag mitsamt seinen Büchern in Brand.
Der von Canetti beschriebene Mangel an Reflexivität wird von Canetti leider selber nicht wirklich durchbrochen: Frauen – wie in so viel Literatur – kommen so gut wie gar nicht, oder in eher unterkomplexen Rollen vor. Der Gegensatz zwischen der notorischen Hausfrau Therese und dem labilen Gelehrten Kien ist eine relativ unoriginelle Schwarz-weiß Zeichnung, die, wenn überhaupt, ein müdes Lächeln erregt. Canetti kann man nicht unbedingt Misogynie vorwerfen.
Abschließend ist das Problem wohl mit Canettis Roman, dass vor allem ein langweiliges Buch ist. Es gibt keinen Spannungsbogen, Ereignisse folgen scheinbar zusammenhangslos aufeinander, Personen verhalten sich stets nach denselben Mustern. Die Sprache ist nüchtern und scharf und wahrscheinlich vollkommen ungeeignet für das Romantisieren der Realität, wie sie andere Autoren verwendet haben. Wie Canetti einmal selbst gesagt hat, geht es ihm um „präzise Übertreibung“ (585), die eine „herkömmliche“ Narrative wahrscheinlich nicht zulässt. Insofern ist „Die Blendung“ vielleicht eine tragische Figur, weil sie – ohne irgendeine Form des spannenden Narrativs – gar nicht anders werden konnte als langweilig.
Allerdings fragt man sich zuletzt: hätte „Die Blendung“ nicht als interessanteres Buch, mit interessanteren Fragen und Figuren und Ideen angelegt werden können? Manchmal lernen wir aus schlechter Literatur vor allem eins: dass Ideen gut und schön sein können, aber in der Realität oder im Text irgendwie nicht funktionieren. „Die Blendung“ scheint darüber hinauszugehen: sie lehrt, dass wenn die Idee schlecht ist, Text und Realität sie nicht besser machen können.
Literatur
Canetti, Elias: Die Blendung. Fischer, 3. Auflage (2017), Frankfurt am Main.
Duzrak, Manfred: Gespräche über den Roman. Suhrkamp (1976), Frankfurt am Main.
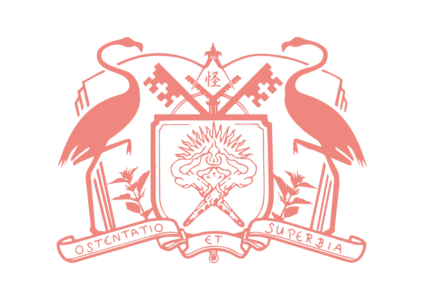
…ob Kien wohl eine Philosophiestudentin, der es gleichgültig zu sein scheint, daß er einmal Kant hieß, in seine Bibliothek einladen würde?
Ich verstehe nicht – warum hieß Kien einmal Kant? Und warum scheint es der Autorin egal zu sein? Bitte um Aufklärung. 😉