Ein Essay
I. Circus Maximus
In einem geteerten Binsenkörbchen ist eine kleine Einsicht den Nil hinabgeflossen: Die Philosophie ist ein literarisches Phänomen. Sie besteht aus Schriften. Richtige philosophische Erziehung ist daher richtiges Lesen richtiger Texte, und richtige Philosophie richtiges Schreiben richtiger Texte. Diese petitio principii der philosophischen Richtigkeit wird den Nil hinauf- und hinuntergebetet, seit die Vorsokratiker auf Einladung Ramses III. im Schatten der großen Zirkel-Pyramide picknickten.
Richtiges Lesen, richtiges Schreiben, und fertig ist die richtige Philosophie? Was wäre denn dann das richtige Lesen, was der richtige Text? Alle philosophischen Systeme und tausendseitige stilistische Entgleisungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Philosophie immer mit der lebendigen Sprache lebendiger Menschen anfängt, die, um überhaupt als „philosophisch“ anerkannt zu werden, bald in einem idiosynkratischen Jargon aufgeht, in dem Autoren, d.h. in der Regel Angehörige bestimmter Traditionen ihre Texte verfassen. Der Jargon ist Panzer und gleichzeitig Eintrittskarte in den eigentlichen Diskurs. Insofern unterscheidet sich der modernste Logiker nicht von Platon oder Heidegger. Alle haben ihre „unvollkommene“ Alltagssprache mithilfe ihrer Lehrer und Bücher in etwas „Höheres“ verwandelt, das komplex und zunächst einmal unzugänglich erscheint. Über jedem Text prangt die unsichtbare Überschrift: Wer hier teilhaben will, muss sich meinen sprachlichen Eigenheiten hingeben. Bevor du selbst philosophierst, musst du dich unterwerfen. Und dazu noch entscheiden: Welcher Weisheitsliebhaber wird dein Sugardaddy?
Bemerkenswert ist, dass man über den richtigen Text nicht während des Lesens und nicht danach urteilen kann, sondern das Urteil vorher fällen muss: Um überhaupt die Entscheidung für oder gegen die Lektüre zu treffen, muss man schon davon gehört haben, muss Erwähnungen des Namens bei anderen Autoren gelesen, ihn bei School of Life gesehen haben. Oder muss durch simple Seminarteilnahme verpflichtet worden sein. Man lernt neue Gedanken immer durch irgendeine Vor-beurteilung kennen, und muss auch das eigene Urteil – Kann ich mich dieser Lektüre verweigern oder nicht? – gefällt haben, bevor eine inhaltliche Rechtfertigung dieses Entschlusses, nämlich durch Analyse des Textes, überhaupt erfolgt sein kann.
Bemerkenswert ist dies im Hinblick darauf, mit welch heiterer Selbstverständlichkeit dieser Zwang zur unbegründeten Wahl negiert wird. Und wie die aufklärerische Forderung, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, quasi dem ideengeschichtlichen Müllschlucker überantwortet wird, ohne dass das ihrer Popularität als Konzept auch nur im Geringsten schaden würde. Anstelle der behaupteten Vernunft wird die Wahl bezahlten Lehrpersonal überlassen oder einfach – dem Zufall.
Zum autonomen Vernunftgebrauch müsste hingegen regelmäßig die gesunde Arroganz gehören, zu sagen: Dieses Schriftstück ist, so dünkt mir, Schwachsinn. Es erscheint mir vor den idiosynkratischen Fragen, die ich mir gegenwärtig stelle, unangemessen. Wenn wir uns nicht ausschließlich der Konvention unterwerfen, sondern unsere Autonomie verteidigen wollen, müssen wir erst einmal unser Selbstvertrauen als Rezipient zurückgewinnen. Wir müssen, so paradox das klingt, unserer intellektuellen Unvollkommenheit vertrauen.
Bildungslandschaft und Kultur lassen uns jedoch zum Gegenteil tendieren. Es ist ja nicht nur sozial verpönt, sondern auch höchst ungeschickt, über gewisse Texte ohne Vorwissen ein Urteil zu fällen, das negativ ausfiele. Denn in diesem Fall wäre die verpflichtende Lektüre, die einzige Eintrittskarte in den ernsten Diskurs unter Fachleuchten, als schlichtweg stupide erkannt. Und wer wollte schon im vollen Bewusstsein, dass es stupide ist, stundenlang Stupides tun? Das würde der Mühe noch die Demütigung hinzufügen. Stattdessen trainieren wir täglich die Fähigkeit, für jede durch noch so blinden Zufall gemachte geistige Bekanntschaft die wunderbarsten Rechtfertigungen zu liefern, wie relevant dieses und wie faszinierend jenes sei. Eine so nachgelagerte Rationalisierung kann jedoch kaum mehr leisten, als die Vor-beurteilungen zu wiederholen, die uns überhaupt zu unserer Entscheidung veranlasst haben, oder den Anschein einer vernünftigen Entscheidung zu erwecken, wo es dafür nie eine Basis gegeben hat.
Wie alle anderen Normalverbraucher schätzen auch pfeifeschmauchende Taxifahrer in spe die Eintracht statt permanenten Widerspruch. Und lieber akzeptieren sie die Autorität des Verfassers und die von ihm selbst oder von hilfreichen Dritten behauptete Relevanz seiner Behauptungen, mit der sie immerhin die eigene Relevanz und Autorität belegen, das leidende Ego balsamieren, die nicht zu beruhigende Unsicherheit über richtig und falsch bei lebendigem Leibe begraben. Unsere Bildungstradition polstert dabei unsere gebeutelten Köpfe auf akademischen Samt, indem sie die jene Stupidität zur Tugend erhebt und sie Fleiß nennt, Disziplin, bewundernswertes Interesse, das honoriert wird mit fürwahr dem höchsten: – Noten! – die bei geschicktem sonstigen Verhalten als Türöffner zu ewigem Ruhm oder zumindest hohem Salär fungieren
II. Sokrates Rückkehr
Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Was ist der richtige Text? Er hängt, so scheint es, vom Leser ab, nicht vom Autor. Nicht der Verfasser, sondern der aus-wählende, urteilende Rezipient verrichtet in der so überreifen Disziplin der Weisheitsliebe die eigentliche Arbeit. Was ist das richtige Schreiben? Es hängt nicht einfach von einer versteckten, durch optimale epistemische Tools aufzuspürenden „Richtigkeit“ von Aussagen ab, sondern von der Auswahl der Zutaten, die zu bestimmten Schlussfolgerungen verleiten. Aus dem Streit um die Methode wird so die Suche nach dem besten Rezept. Und aus dem Kampf um Wahrheit die Diskussion um den besten Geschmack.
Dass, nicht wie man einen Text liest, ist entscheidend. Denn selbst, wenn man alle darin vertretenen Thesen ablehnt, werden diese immer als Korrektiv präsent bleiben, als Herausforderung, die das weitere Denken bestimmt. Ein falscher Text ist nicht einfach einer, dem ich aufgrund meiner wahren Überzeugungen über die Welt nicht zustimmen kann, sondern einer, der mich bei meinen derzeitigen Fragestellungen behindert, mich großväterlich beruhigt, dass die mich quälenden Fragen gar nicht so dringlich seien wie die, für die jener falsche Text wirbt.
Wir haben daher Sokrates Frechheit, mit der er die scheinbar sakrosankten Überzeugungen seiner arbeitsamen und dabei engstirnig gewordenen Mitbürger angriff, nötig. Nicht in dem Sinne, unsere Überzeugungen mit stetig neuem Zweifel zu konfrontieren, eine Skepsis, die in uns Intellektuellen längst zu tief eingesickert ist. Sondern, um unsere Idee, es gebe gewisse Voraussetzungen für richtige Philosophie, die wir kennen, beschreiben und forcieren können, aufgeben zu lernen. Wir müssen uns auf den geschmacklichen Wettkampf einlassen, auf den großen Streit nicht nur der Thesen, sondern der Systeme, nach denen wir Thesen aufstellen, diskutieren und beurteilen. Mehr als unsere Thesen und Argumente müssen wir unser philosophisches Stilbewusstsein, unseren intellektuellen Habitus weiterentwickeln.
Es gilt, nicht einfach weiter die argumentativen Klamotten der Gegend, in der wir mehr aus Zufall denn aus vernünftiger Entscheidung sozialisiert wurden, für den modischen Gipfel der Welt zu halten. Es geht nicht einfach darum, gewisse Überzeugungen für Kritik offenhalten, sondern vor allem die Art und Weise, wie wir Kritik an Überzeugungen zu formulieren und abzuwehren gewohnt sind. Und hier liegt einiges im Argen.
III. Das Unbehagen
Das Unbehagen in der Philosophie lässt sich zunächst als Irritation beschreiben, als Überraschung darüber, dass eine Disziplin, die zumindest die Möglichkeit von Rationalität als Kernannahme verteidigen muss – denn was bliebe von jeder philosophischen Aktivität, würde sie nicht einmal die Möglichkeit zugeben, sie sei rational und damit vielversprechend – so wenig Rationalität an den Tag, was ihre interne Wissensökonomie angeht: das System, nach dem sie Wissen produziert, handelt und aussortiert.
Das Unbehagen liegt in einer selten genug, zumeist spät nachts aufflackernden angstvollen Ahnung begründet, dass gerade die drängendsten Probleme niemals gelöst werden, weil niemals wirklich bearbeitet, sondern immer nur sprachlich neu gefasst, auf unbekannte inhaltliche Ebenen verschoben, mit verändertem Fokus neu beschrieben, unter immer schillernderen Sprachschichten verdeckt werden. Wobei der Betrug, wie wenig Substantielles im Hinblick auf die drängendsten, auch chronologisch ersten Fragen gesagt wurde – Warum töte ich nicht aus Langeweile – Warum höre ich nicht auf zu leben – Warum hat irgendetwas, das irgendjemand sagt, irgendeine Autorität – Was gibt es in der Welt, was nicht auf Macht reduziert werden kann – hinter all den Satzwindungen nicht mehr zum Vorschein kommen darf und mit rhetorischen Spezialeffekten verdeckt werden muss: je nach Tradition, Geschmack und Begabung mit stilistischer Brachialität, angsteinflößendem Formalismus, syntaktisch-lexikalisch-metaphorischen Massakern oder hochdiffizillen Begriffsunterscheidungen, bis sich jedes Wort nur so weit von seiner Alltagsbedeutung entfernt hat, dass es geradezu in einer Geheimsprache aufgeht.
Dabei sind alle eigentlich verwundbaren Punkte irgendwo jenseits des Riffs des Jargons verborgen, auf das der noch unvereidigte Schüler auflaufen muss. Wie der mittelalterliche Handwerker erst abweichende Meinungen vertreten durfte, nachdem er seinen Meistern lehrjahrelang nach dem Mund geredet hatte, ist auch heute noch ein durch jahrelanges Studium interdependenter, hochkomplexer Sprachsysteme unter Beweis zu stellendes Glaubensbekenntnis zu der erst noch zu kritisierenden Tradition Bedingung für deren Kritik.
Dieser doppelte, zuerst rhetorische, dann sektiererische Betrug muss bei allen, die nicht bis in ihre letzte Faser hinein philosophische Illusionisten geworden sind, ein Schuldgefühl erzeugen. Dieses muss lange und gerade im akademischen Bereich unterdrückt werde, um überhaupt irgendein Fortkommen zu ermöglichen, und erzeugt auf diese Weise das Unbehagen.
Die Philosophie, die wir bräuchten, sollte etwas für jeden Einzelnen nicht nur Mögliches, sondern Unumgängliches sein. Immerhin wird das Individuum in der liberalen Demokratie zur letzten Bezugsgröße erklärt. Soll eine solche Demokratie nicht schon auf den ersten Blick unvernünftig erscheinen, so sollten die Einzelnen, auf denen sie aufbaut, fähig sein, die Lage vernünftig, argumentativ, sprich philosophisch zu durchleuchten. Eine Philosophie aber, die nur aus Neigung oder Langeweile betrieben wird, deren Ergebnisse werden immer den Status einer Wahrheit zweiter Klasse behalten, ähnlich der Lösung eines Sudokus: möglicherweise genial, aber für den Rest des Tages uninteressant. Und das ist insofern besonders lustig und tragisch, als die Philosophie mehr als jede andere Wissenschaft immer darauf bestanden hat, erstklassige, unhintergehbare, von Zeit zu Zeit sogar allgemeingültige Wahrheiten zu produzieren.
Die derzeitige Philosophie ist im scharfen Kontrast zu dieser geradezu pubertär erscheinenden Vorstellung vielmehr ein Literatur-Zirkel, dessen Mitglieder alle die gleichen Bücher gelesen haben, sich darüber austauschen, darüber schreiben und sich gegenseitig zitieren. Die sogenannten drängenden Fragen, die sich in allen menschlichen oder politischen Extremsituationen stellen, berühren indes das Interesse jenes Zirkels höchstens zufällig.
In den Chor derer einzustimmen, die die Abgehobenheit der Wissenschaften und besonders der Philosophie beklagen, ist weder originell noch vielversprechend. Doch es bleibt der Umstand, dass sich die Bindungskraft der akademischen Philosophie in der Praxis auf die Angehörigen des akademischen Betriebs beschränkt, die wirtschaftlich und oft auch sozial von ihm abhängig sind. Die Lösungen der drängenden Fragen werden in der Praxis längst auf andere Weise, vor allem in der Sphäre des Politischen, nicht nur veranlasst, sondern auch entwickelt.
Die mehrfache Absicherung der eigenen Glaubenssätze durch die Macht über den Kanon und die rhetorischen Spezialeffekte, das Riff des Jargons – Mittel, durch die sich wohl jede Position jahrhundertelang aufrecht erhalten ließe – ist nur um den Preis der internen Aufrichtigkeit und der externen Relevanz zu haben. Die Philosophen verkaufen gewaltige Mengen Aufrichtigkeit und Bedeutung für winzige Fetzen scheinbarer intellektueller Sicherheit, die sie einander in ihren akademischen Zirkeln gegenseitig schenken. Dass dies von manchen noch als guter Tausch empfunden wird, verweist auf eine groteske Verdrehung von Mittel und Zweck: Da werden „sichere“ Aussagen oder Systeme höher geschätzt als solche, die aufrichtig oder für irgendeine Öffentlichkeit relevant wären.
Das Unbehagen in der Philosophie kann also beschrieben werden als das lang unterdrückte, kaum noch wahrnehmbare Symptom eines tieferliegenden Problems, als die apokalyptische Posaune des Unbewussten, die den weitgehenden Verlust des Kontakts zur gesellschaftlichen Realität verkündet. Es entspricht in etwa dem möglicherweise ab und zu auftretenden Zweifel eines Psychotikers an jener künstlichen Realität, die er aufgrund seiner Erkrankung für die einzige wahre halten muss. Die Philosophie sollte analog – insofern sie nicht auf externe oder gar medikamentöse Behandlung bauen kann – dringend ihre eigene künstliche Realität hinterfragen, um den cartesischen Dämon des Betriebs zu bannen, der sie mit dem Versprechen von ‚sicherer Wahrheit‘ erst zur vollkommenen Illusion verführt hat. Oder sie muss sich zumindest, um mit Freud zu reden, klar verdeutlichen, in welchem Maße sie nicht Herr im eigenen Hause ist. Wie sie im Anschluss lernt, mit dieser traumatischen Wahrheit zu leben, ist weniger eine akademische als eine therapeutische Frage.
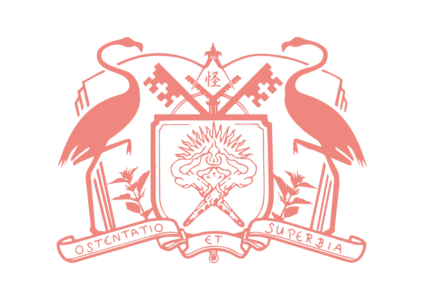
5 Kommentare zu „Das Unbehagen in der Philosophie“