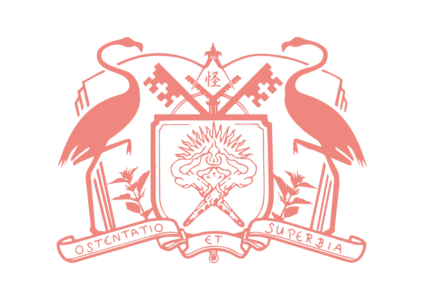Replik zum Tag der Frau, du Arschloch!
Es ist einfach, über alle möglichen Begebenheiten zu schreiben, wenn man in einer privilegierten Position ist. Tagespolitik, Kriege, kanonische Werke, Solidarität, Empörung – überall und nirgendwo kann sich die Aufmerksamkeit enthalten, kann zugreifen, wenn es beliebt. Aber es ist nicht einfach darüber zu schreiben, was misslingen kann, wenn man dieser Privilegien beraubt ist. Denn wer wäre man schon, sich anzumaßen, seinen Senf dazugeben zu dürfen? Wie würde man gehört werden? Allein dies erinnert daran, dass nicht jede:r in jeder Situation auch alles sagen kann. Und das wiederum erinnert daran, dass es auch nicht angemessen ist, wenn jede:r immer zu jede:m Zeitpunkt alles sagen zu dürfen meint. Vor allem dann nicht, wenn das Gesagte aus einer Position des Privilegs kommt. Manchmal ist das Schweigen, das Innehalten, das einzig Angemessene.
Bei der Erinnerung an das Marginalisierte denke ich aber auch an das Verschweigen, das Gescheiterte, Unterdrückte, Nicht-Gesagte, Vernuschelte selbst. In der unmittelbaren Gesellschaft in der ich lebe, aber auch in der Welt, in der ich ungeheure Privilegien besitze. Wie könnte diese Welt aussehen, wenn all das Nicht-Gesagte plötzlich gesagt werden könnte, das Schweigen gebrochen, das Neue, das Ungewohnte, das Fremde, das Marginalisierte ins Offene tritt? Zu was also – so schießt mir zu diesem Bezug in den Kopf – ist unsere Fantasie noch im Stande? Ich hoffe, zu diesem Zeitpunkt sagen zu dürfen, sagen zu können, aus einer Position des Privilegs, aber auch aus einer Position der Empathie, der Einfühlung in die Marginalisierung: zu viel. Das ist Hoffnung. In diesem Fall erwächst sie einer persönlichen Perspektive – sie ist in keiner philosophischen Weise begründet. Die Hoffnung erwächst einem Wunsch. Und auch Erinnerungen.
Wann habe ich zuletzt ernsthaft eine Bewerbung zusammengestellt? Ganz vor kurzem. Wurde ich aussortiert? Natürlich nicht. Wurde ich gefragt, ob ich eigentlich Klavier spiele? Natürlich nicht. Wurden sonstige Details erfragt? Natürlich nicht. Wurde ich angenommen? Natürlich. Diese Voraussetzungslosigkeit, die mir hier als Bewerber zugestanden wird, dieses bedingungsloseVertrauen des Gegenübers in vorliegende Eignung, Sinnhaftigkeit, Richtigkeit: das ist Privileg. Es ist das Fehlen von Konditionen, Bedingen, Boxes, die getickt werden, Listen, Wartezimmer, in denen man sich aufhalten, Schubladen, in die man erst einsortiert werden muss. Privileg ist, wenn man bereits einen Freibrief besitzt, quasi eine Art Blankocheck. (Wie zynisch, dass ein Blankocheck schon per Definition weiß ist. But anyway.)
Ich kann mich noch sehr gut, sehr frisch an Situationen erinnern, in denen ich keinen Freibrief besaß. In denen ich mir kleine Freiheiten erkämpfen, ermogeln, erbitten musste. Kampf um Freiheit, Kampf um kleinliche Freiheiten, um Frei-Gestellt-Sein von Bedingungen, Listen, Vorbedingungen: das ist Emanzipation. Auch aus einer Position des Privilegs geht man manchmal eine Emanzipationsbewegung durch. Emanzipation, Befreiungskampf, das ist ein Kampf um den Alltag, in der man per Definition unten beginnt und gegen einen überlegenden Feind kämpft, der oben sitzt. Es ist ein ‚uphill battle‘, hügelaufwärts, ein Kampf der kleinen Schritte, der Versteckungen, der Schutzreflexe, in dem man zeitgleich offensiv und defensiv agiert. Gibt es einen schwierigeren Kampf als diesen? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Manche starten weiter oben am Hügel, manche weiter unten. Ich startete recht weit oben. Meine Emanzipationsbewegung war also vergleichsweise leicht. But an uphill battle it was, albeit a short one.
Was habe ich mich über die ausgegebenen Bewerbungsgebühren geärgert! Über Absagen, über Mangel an Respekt. Oder Einfühlung, Empathie, Interesse. Daran, dass andere Leute ernst genommen wurden, ich nicht. Andere Leute, die es sich nicht wert waren, mir Aufmerksamkeit zu widmen, mich als einer ihresgleichen zu begreifen. Texte, Ideen, Lebensläufe – ungeliebt, ungelesen, unverwirklicht, auf Festplatten, in ungelesenen, ungeöffneten Briefen, in Stillschweigen und nie eintrudelnder Antwort. Oder die Kommentare: ‚Kannst du segeln?‘ ‚Verkneifen Sie sich die Manierismen‘. ‚Sie beziehen sich nicht auf die relevanten Autoren.‘ ‚Nicht genügend Quellen‘. ‚Spielst du kein Tennis?‘ ‚Sie zitieren zu wenig.‘ ‚Sie zitieren zu viel.‘ ‚Wir verstehen nicht, worauf Sie hinauswollen.‘ Stillschweigend füge ich hinzu: ‚Und Sie werden sich auch keine Mühe geben.‘
Wo sitzt der Feind, bei diesem Kampf hügel-aufwärts? Er sitzt nicht in Gestalt von Menschen, Institutionen, Gesichtern vor einem, auch wenn einem das erst einmal so vorkommen mag. Der Feind operiert in Gestalt von Konventionen. Von ungeschriebenen Regeln. Von Tradition. Von ‚Das haben wir schon immer so gemacht‘ über ‚das ist mir neu‘ hin zu ‚ich kenne diesen Namen nicht, also muss er irrelevant sein.‘ Konventionen bricht man, indem man sie erkennt. Und sie sich aneignet. Indem man sie lebt, sie so endlos und sinnlos wiederholt, bis sie zu eigenem Fleisch und Blut werden, indem man die Schläge pariert, sie lernt, bis man sie besser anwenden kann als der Gegenüber, die Namen besser kennt, besser zerstören, die Verachtung für sie besser verstecken kann als das Gegenüber. Und dann, ein Schritt vorwärts. Und dann noch einen. Und sich dann wieder eine Konvention zu eigen machen, und sie schlussendlich brechen. Das ist ein Weg des hügelaufwärtsgerichteten Kampfmodus, der Emanzipationsbewegung, der Befreiung von dem Regelwerk. Ist es der einzige Weg? Keine Ahnung. Es ist der einzige, den ich kenne. Wenn es etwas gibt, wo wir voneinander lernen können, dann vielleicht über individuelle Kampftechniken der hügelaufwärtsgerichteten Alltagsaneignung. Ist das schon Solidarität? Die Feministinn:en, die ich kenne, bezeichnen die gemeinsame Unterstützung im Emanzipationskampf als Solidarität.
Einige Jahre später. Um mich herum laufen besoffene Privilegierte mit Roben und Hirsch- und Schweinemasken vor jahrhundertealten Ölgemälden in jahrhundertealten Hallen, in denen sich für Jahrhunderte Privilegien angesammelt, Konventionen verdickt, angestaut, angestaubt haben, bis die Luft und der eigene Freiraum so eng ist, dass man sich hier nur bewegen kann, wenn man einen absolute Freibriefe hat, ganz oben auf dem Hügel steht, jede Konvention brechen, mit den eigenen Privilegien abwehren kann. Die Leute hinter den Masken saufen direkt aus Portweinflaschen, sie sind unglaublich vulgär. Ich könnte das auch tun. (Ich tue das vielleicht manchmal auch.) Denn ich gehöre dazu. Heute nicht, ich bin gelangweilt, ich gehe nach Hause. Eine Robe flattert hinter mir her; ohne Schweinsmaske sehe ich vielleicht aus wie eine jüngere Version Professor Lupins, dem troubled Lehrer für ‚Verteidigung gegen die dunklen Künste‘ aus dem vierten Film von Harry Potter.
Was ist passiert? Wie konnte eine Emanzipationsbewegung so schnell, so vergleichsweise erfolgreich den Hügel bezwingen oder zumindest einen komfortablen, höher gelegenen Abhang erreichen, auf dem man sich gelassen und Portwein trinkend, nur jovial pöbelnd, ausruhen kann? Was gibt einem die Kraft, das Durchhaltevermögen? Wenn ich daran denke, fallen mir wieder nur Privilegien ein. Kleine, darunter geschichtete Gruppen und Absicherungen an Privilegien, auf die mich zurückziehen konnte, wenn eine Konvention sich mal als härter zu knacken erwies als angenommen, wenn von hügelaufwärts mal Gegenwind kam, dumme Fragen, dumme Kommentare, Unverständnis, Desinteresse. Erinnerungen an bereits durchwandelte konventionsverdickte Räume. An ehemals ausgestellte Freibriefe. An Schulterklopfer, an Ernst, an Ehrlichkeit, an Aufmerksamkeit, an Ermutigung, an basales, unhinterfragt gegebenes Vertrauen. Schon das ist Privileg. Was für ein Privileg, nicht gemustert zu werden, wenn man den Raum betritt! Was für ein Privileg, den richtigen Namen, das richtige Aussehen, das richtige Geschlecht im Großteil der Fälle zu haben; Hilfe meist ungebeten angeboten zu bekommen, an Interesse an der eigenen Person überhaupt erstmal ansatzweise gewohnt zu sein. Von dem (wenigen), was ich an intersektionalem Feminismus verstehe, ist das doch die grundlegende Idee: dass bereits der Raum der Marginalisierung geschichtet ist, gewisse Marginalisierungen immer noch privilegierter sind als andere, man nicht in groben Kategorien denken und auch nicht unterstützen kann, dass auch die sich hügelaufwärtsbewegenden Alltagsaneigner:innen nicht alle vom gleichen Abhang starten, manche Abhänge immer noch tiefer liegen. Meiner lag ziemlich hoch, wenn überhaupt mitteltief.
Es ist paradox: um sich wirklich emanzipieren zu können, muss man bereits zu einem gewissen Maße privilegiert sein. Um lesen zu können, muss man bereits gelesen haben, um hügelaufwärts gehen zu können, bereits einen Schritt gegangen, oder vielleicht geschubst, geschoben worden sein. Widerstand muss man nicht nur leisten, man muss ihn sich auch leisten können. Und das Können, das ist Privileg. Es ist ein Privileg, das uns allen zusteht, allen gleichermaßen. Weil es keine natürlichen Hierarchien gibt, nicht geben kann, nicht geben soll, weil wir der Auflösung der Hierarchien, der Herrschaft, der Regeln Schritt für Schritt entgegen gehen müssen, die Knoten lösen, die Konvention, die uns umgeben, brechen müssen, bis ich unbeschwert eine Schweinsmaske tragen und du unbeschwert zu sexistischem Hip-Hop tanzen darfst. Bis wir uns Fehler erlauben dürfen, weil wir alle einen Freibrief haben. Wir alle verdienen einen Freibrief.
Woher kommt die Hoffnung? Meine Hoffnung erwächst aus der Frage: Wozu ist unsere Fantasie noch im Stande? Wenn ich an eine Sache denken kann, wozu Fantasie eigentlich recht gut im Stande ist, dann ist es, das Wirkliche dort zu sehen, wo es noch nicht wirklich ist. Das noch nicht Verwirklichte zu denken. Es sich wenigstens vorzustellen: das ist fantastisch. Ich kann mir vorstellen, den Menschen um mich herum die Aufmerksamkeit zu widmen, die ihnen natürlicherweise zusteht. Sie ernst zu nehmen, ihnen das zu geben, was sie noch nicht haben: die privilegierten Situationen, ungefragt gehört zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns alle gegenseitig Privilegien zugestehen, und schrittweise gegenseitig mehr und mehr Freibriefe ausstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns gegenseitig den Hügel hinaufziehen.
Illustration von Hannah Eirich