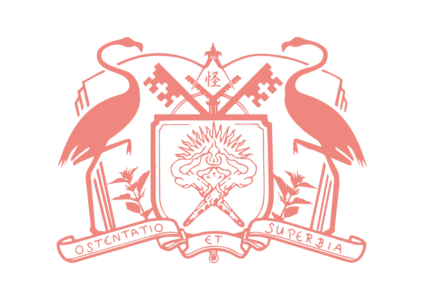Die Ironie ist als rhetorisches Mittel so tief in unserem alltäglichen Sprachgebrauch verankert – unserer Interaktion mit anderen und der Auseinandersetzung mit uns selbst -, dass wir ihre vielfältigen Dimensionen oft gar nicht hinterfragen. Sie kann Witz und Waffe sein, sie kommuniziert Leichtigkeit und dient als sardonische Fassade. In jedem Fall stellt die Ironie ein Instrument der Verfremdung dar, das das Sichtbare trüben und das Trübe sichtbar machen kann.
Im Zeitalter der digitalen Kommunikation hat die Ironie Hochkonjunktur: Über Memes, GIFs und all die lustigen Bewohner des Internets verbreiten wir Botschaften mit humoristischer Verzerrung. Diese Form der Kommunikation beflügelt den allmählichen Abschied von alten Gewissheiten, den unsere Gesellschaft derzeit erlebt: für die einen von den universellen Wahrheitsansprüchen von Kultur und Wissenschaft, die über Jahrhunderte lang bestehende Hierarchien stützten; für die anderen von der vermeintlichen Last, sich für die eigenen Aussagen verantworten zu müssen. Beide Anwendungsformen der Ironie spielen mit der Verortung des Selbst und streben bestimmte Formen der Distanzierung an – doch ihnen liegen unterschiedliche Verständnisse von Ironie zugrunde.
Ein Autor, dessen Ironiebegriff auf die Distanzierung von universalistischen Erzählungen zielt, ist der US-amerikanische Philosoph Richard Rorty. Für Rorty sind Ironikerinnen und Ironiker Menschen, die von der Kontingenz und der historischen Bedingtheit ihrer Ansichten und ihres Selbst überzeugt sind. [1] Sie sind der Meinung, dass Sprache keine ultimative und universelle Wahrheit wiedergibt, sondern aus geschichtlich verankerten Machtverhältnissen entsteht. Eine Ironikerin hegt deshalb stets Zweifel an der Finalität und der allgemeinen Gültigkeit jenes Vokabulars, das sie oder ein anderer benutzt. Weil sie im Laufe ihres Lebens von verschiedenen Vokabularen und Ordnungen zur Beantwortung moralischer und ontologischer Fragen konfrontiert war, ist eine Ironikerin „nie ganz dazu in der Lage, sich selbst ernst zu nehmen“. [2] In anderen Worten: Sie verortet unsere Wissensordnung und damit ihre eigene Perspektive in einem begrenzten, raumzeitlichen Kontext, der immer potentiell veränderbar ist.
Historisch gesehen war und ist die etablierte Wissensordnung mit einer Machtasymmetrie verbunden, die das Westliche, Weiße und Männliche privilegiert. Laut Donna Haraway, Vertreterin eines feministischen Post-Humanismus, wird diese Ordnung durch eine Art Trick erhalten: Von der privilegierten Position aus bedient ein Sprecher das Narrativ universeller Wahrheit, indem er sich von seiner eigenen Situiertheit loszulösen versucht. [3] Damit tut er, als stünde er über den Dingen – und als beruhe seine Sicht nicht auf seiner Identität und diese wiederum nicht auf den historisch bedingten Eigentümlichkeiten seiner Sozialisation. Indem Haraway stattdessen die Geschichtlichkeit und Erfahrungsgebundenheit dessen betont, was wir „Wissen“ nennen, wird sie zur Ironikerin. Ein Bewusstsein für unsere Situiertheit wird für sie zur Grundlage, um Verantwortung für die eigenen Wissensansprüche zu übernehmen.
Das Gegenteil davon gilt für den zuvor genannten Wunsch, nicht für die eigenen Aussagen verantwortlich gemacht zu werden. Eine solche Einstellung wird im Englischen wird „ironic detachment“ genannt.
Der Begriff beschreibt eine Mentalität, die in ihrer ironistischen Distanzierung vom ernsthaften Diskurs zweierlei suggeriert: dass man nämlich nicht am Diskurs beteiligt sei und dass man ihn als solchen ablehnt. Klar, vielleicht kann man manchen Debatten legitimerweise ihre Ernsthaftigkeit absprechen („Querdenker“ do exist). Doch häufig steckt hinter jener Loslösung ein Abwehrmechanismus, der sich im Wunsch äußert, nicht für die eigenen Aussagen haften zu müssen.
In einer solchen Haltung wird die Ironie zum Schild, um Kritik von vornherein unmöglich zu machen. Indem man sich dem Diskurs entzieht, negiert man die Vokabulare, die Ansichten der anderen. So stellt man sich nicht nur der Neubeschreibung in den Weg, sondern der Beschreibung überhaupt. Der Rückgriff auf Ironie zielt hier nicht auf den produktiven Dissens. Er zielt auf Unangreifbarkeit – und verkörpert so den verkürzenden Wunsch nach Finalität.
Hier wird das Risiko der Ironie deutlich: dass sie nämlich nicht nur als Mittel zur Distanzierung vom eigenen Wahrheitsanspruch, sondern auch als Mittel zur Distanzierung von der eigenen Verantwortung gebraucht werden kann. Womöglich ist das die Ursache dafür, dass Rorty der Ironie im Privaten einen hohen Wert zuschreibt, sie aber für die politische Kommunikation für ungeeignet hält: sie diene der Selbsterschaffung, nicht der Gemeinschaftsbildung. [4]
Ironie fördert die individuelle Selbsterschaffung wohl vor allem als Element der Verfremdung, auf das man sich wie auf ein Risiko einlässt, um später zur eigenen Identität zurückzufinden. Es bedarf eines gewissen Mutes, vom eigenen Selbst abzukehren und dieses in der Ironie zu verdrehen. Doch zu wissen, wer man ist, und sich nach dem Prozess der Selbstdistanzierung als die gleiche oder womöglich als eine leicht veränderte Person zu akzeptieren, prägt uns als Individuen. Durch die Selbstironie erkennen wir Fragilität und Unzulänglichkeiten an. Wir akzeptieren die eigene Imperfektion ebenso wie die Tatsache, dass wir uns ständig neuerschaffen. Eben dadurch gelingt es uns, Achtung vor uns selbst und unserer Situiertheit zu gewinnen. Wie Rorty schreibt: „Wir Ironiker hoffen, daß wir uns mit dieser ständigen Neubeschreibung das beste Selbst, das uns möglich ist, erschaffen. [5]
Eine ähnliche Idee geht von der deutsch-amerikanischen Denkerin Hannah Arendt aus, die das Verstehen als einen nicht-endenden Prozess der Neuverortung des Selbst interpretiert. [6] Arendt sah in der Suche nach Neubeschreibung aber nicht nur persönlichen Nutzen, sondern hielt diese für essenziell für eine kritische Öffentlichkeit. So zeigt sich in der Kompetenz der Selbstdistanzierung eine Einstellung, die den liberalen Diskurs als Ganzen stärkt. Sie befähigt uns zum Perspektivenwechsel und wird zur Voraussetzung, um die Hinfälligkeit des eigenen Weltbilds zu akzeptieren. Dadurch können wir als Mitglieder einer pluralen Gesellschaft aufeinandertreffen, die keine Schlussstriche hinter vermeintlich universell gültige Erzählungen setzt.
Stattdessen betont ein verantwortungsvoller Ironismus ein Bewusstsein für die Kontingenz unserer Perspektive und lässt sich so einfacher auf die ergebnisoffene Interaktion mit anderen ein. Für Verkürzung und Endgültigkeit bleibt kein Raum mehr. Auf diese Weise erneuern wir, wie Arendt es fordert, den öffentlichen Diskurs immer wieder und verorten auch uns selbst ständig aufs Neue. Wir streben keine ultimative Wahrheit mehr an, die uns auf ewig von moralischer Reflexion befreit, sondern lassen uns auf einen langfristigen individuellen und gesellschaftlichen Lernprozess ein. Dieser basiert darauf, dass wir unser Weltbild und die Machtverhältnisse, die es stützt, als veränderlich anerkennen. Indem wir den Wahrheitsanspruch fallenlassen, gestehen wir anderen Individuen jene Achtung zu, die wir für uns selbst beanspruchen – und erwarten dasselbe von ihnen.
Wird aber die ironische Verfremdung nicht zum Mittel, um die Kritikwürdigkeit der eigenen Perspektive anzuerkennen, sondern um Kritik von vornherein unmöglich zu machen, gibt es keine Möglichkeit zu lernen. Wir versperren uns jeder Form des individuellen und gesellschaftlichen Wandels. Noch dazu erreichen wir durch die Distanzierung vom ernsthaften Diskurs und einer x-beliebigen Aussage, die wir treffen, einen Relativismus, der jegliche Form von Verantwortung zunichtemacht. „Relativism is a form of being nowhere while claiming to be everywhere equally”, schreibt Donna Haraway. [7] Anders ausgedrückt: Relativismus und Universalismus sind Kehrseiten der gleichen Erzählung; nämlich der, dass wir etwas behaupten und dann so tun könnten, als hätte unsere Behauptung keine Wurzel. Als existiere sie ohne unseren Körper und unsere Identität. Als träfe sie nicht auf den Kontext unserer Mitwelt. Und als müssten wir uns deshalb nicht für sie verantworten.
Verantwortung haben wir allein deshalb, weil wir unsere Aussagen eben nicht im Vakuum treffen. Wir prägen durch unser Sprechen und Handeln unsere Mitwelt ebenso wie sie uns. Verortung heißt Verantwortung: Indem wir uns positionieren und die beschränkte Gültigkeit unserer Position ironisch anerkennen, stehen wir für unsere Aussagen ein, ohne sie zum imperativen Maßstab zu machen.
Die Idee, das Subjekt könnte sich dieser Verantwortung durch die ironische Loslösung entziehen, macht in ihrer Willkür Aussagen bedeutungslos. Entweder mündet ironic detachment daher schnell in den Nihilismus; oder er bedient einen Revisionismus nach dem Motto „Das war nicht so gemeint“, den so viele Populisten gerne nach Belieben einsetzen. In jedem Fall versperrt er sich einer Beschreibung des Jetzt und einer Gestaltung des Morgen.
Wer mit der Ironie aufklären statt verschleiern will, die eigene Verortung preisgibt statt Entwurzelung zu predigen, versteht Differenzen als legitim und ermöglicht so den pluralen Diskurs. Er oder sie lässt sich auf Irritationen ein, sucht sie geradezu. Sicherlich findet ein solcher Ironiebegriff am ehesten in einer Nische Anklang, in der die Belesenheit und Offenheit für andere Perspektiven ausgeprägt sind, etwa bei liberalen Intellektuellen; auch die ironische Grundhaltung ist schließlich nicht universell gültig. Davon mal abgesehen, kann es sich eine auf Effizienz ausgerichtete Gesellschaft überhaupt nicht leisten, ständig ihre Denkkategorien zu hinterfragen. Nicht jede Person kann Ironikerin sein.
Das wäre auch gar nicht der Anspruch einer Einstellung, in der die Gleichzeitigkeit der Erzählungen und die Konkurrenz der Singularitäten zu Tugenden statt zu Hindernissen werden. Ironie wird so zu einer Alternative zu Universalismus und Relativismus. Sie kommuniziert ein Bewusstsein für die Situiertheit unserer Perspektive und hilft uns, uns in der Welt zu verorten. Damit denkt sie die historischen Voraussetzungen für unsere Position mit und strebt danach, diese wandelbar zu gestalten.
– Felix Meinert
Bibliographie
[1] Vgl. Rorty, Richard (1999): Kontingenz, Ironie und Solidarität, 5. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 14.
[2] Ebd.: S. 128.
[3] Haraway, Donna (1988): Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, in: Feminist Studies 14 (3). S. 575-599.
[4] Vgl. Rorty 1999: S. 150.
[5] Ebd.: S. 137.
[6] Vgl. Arendt, Hannah (2012): Zwischen Vergangenheit und Zukunft. München: Piper. S. 110.
[7] Haraway 1988: S. 584.