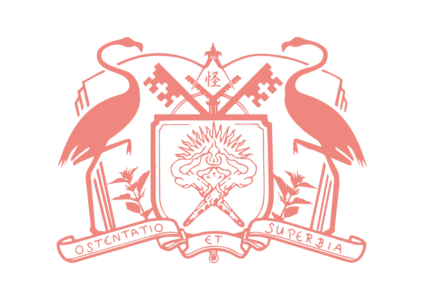Eine Buchkritik
Schon seit Jahrtausenden sind die Vorstellungen der Menschen über Tiere durch Narzissmus, Unwissenheit oder auch Romantisierungen verzerrt. In der Bibel wurde der Mensch als das Abbild Gottes dargestellt, der von Gott den Auftrag erhält, über die Erde mit all ihren Geschöpfen zu herrschen. In der Neuzeit wandelt sich das Bild drastisch: Tiere sind nichts weiter als Automaten, während der Mensch mit seiner Vernunft über ihnen steht. Somit wurden ihnen auch jegliche Emotionen und Empfindungen abgesprochen. Daher war es über lange Zeit völlig legitim und ethisch unbedenklich, Tiere bei lebendigem Leib zu sezieren. Auch heute ist eine etwas abgemilderte Version dieses Tierbilds unter Wissenschaftlern und in der Öffentlichkeit zu finden. Daneben findet sich noch ein anderes Tierbild, welches vor allem unter Haustierbesitzern, die oft dazu neigen, ihren geliebten Vierbeiner durch eine rosarote Brille zu betrachten, weit verbreitet ist. Oft behaupten sie: „Tiere sind die besseren Menschen.“ und „Nur mein Hund versteht mich wirklich.“
Bis vor kurzer Zeit hat die Verhaltensbiologie diese beiden Tierbilder miteinander vermischt. Ihre grundlegenden Dogmen lauteten somit: „Tiere können nicht denken, und über ihre Emotionen können keine Aussagen getroffen werden. […] [Und] Tiere verhalten sich zum Wohle der Art. Sie töten keine Artgenossen und helfen einander bis zur Aufopferung.“[1] Mittlerweile findet in der Verhaltensbiologie ein Paradigmenwechsel statt. Zu welchen erstaunlichen Ergebnissen die Forschung in diesem Gebiet in den letzten Jahren gekommen ist, stellt Norbert Sachser, Verhaltensbiologe und Professor an der Universität Münster, in seinem Buch Der Mensch im Tier. Warum Tiere uns im Denken, Fühlen und Verhalten oft so ähnlich sind, das dieses Jahr im Juli erschienen ist, sehr anschaulich dar. Dabei geht er auf 246 Seiten Fragen nach kognitiven Leistungen, Emotionen, Rolle der Genetik, Charakterbildung und Verhalten gegenüber Artgenossen bei Tieren nach. Insgesamt gliedert sich das Buch in sechs Kapitel (ohne Einleitung und Schluss) mit Titeln wie Der rote Emil ist nicht gern alleine oder Wenn die Katze spielt, geht es ihr gut, die auch unabhängig voneinander gelesen werden können. Sachser verzichtet bei seinen Ausführungen darauf, mit vielen Fachbegriffen um sich zu werfen und erklärt stattdessen vieles mit anschaulichen und unterhaltsamen Beispielen, sodass das Lesen des Buchs sehr kurzweilig ist. Die hier vorgestellten Forschungsergebnisse sind erstaunlich, denn sie zeigen ein deutlich differenzierteres Tierbild, als bisher postuliert.
So sind Tiere weder vollständig genetisch determiniert, noch haben sie keine Emotionen, noch sind sie charakterlich gleich und völlig irrational. Es gibt zwar gewisse genetische Anlagen für bestimmte Charaktereigenschaften. Allerdings ist die Umwelt, in der ein Tier aufwächst ein ganz entscheidender Faktor für das spätere Verhalten. Sachser erläutert dazu ein Experiment, das mit Ratten durchgeführt wurde. Es wurden zwei Gruppen von Ratten gezüchtet: Die eine bestand aus äußerst intelligenten Tieren, die andere aus eher dummen. Man hat die intelligenten Ratten in einem kleinen Käfig ohne Spielmöglichkeiten gehalten und die dummen Ratten in einem großen mit vielen Spielmöglichkeiten. Dabei konnte beobachtet werden, dass unter diesen Bedingungen die dummen Ratten am Ende sogar intelligenter waren als die Gruppe mit den eigentlich intelligenten Ratten. Als Maßstab für die Intelligenz diente bei diesem Experiment, wie schnell und zielstrebig die Ratten ein Labyrinth durchquerten.
Von der Umwelt hängt auch ab, wie sich der individuelle Charakter eines Tieres entwickelt. Es konnte gezeigt werden, dass es im Tierreich Optimisten und Pessimisten gibt, je nach den Erfahrungen, die ein Tier gemacht hat. Bereits in der pränatalen Phase werden durch hormonelle Einflüsse der Mutter auf den Fötus die Grundsteine für das Verhalten der Tiere gelegt. Nach der Geburt eines Tiers hängt schließlich viel davon ab, wie sich die Mutter um ihren Nachwuchs kümmert und wie stabil und sicher die Lage ist, in dem ein Tier heranwächst. So weist ein Tier, das in einer unsicheren Umgebung aufgewachsen ist, ein eher ängstliches und zurückhaltendes Verhalten auf, was die Überlebenschancen erhöht. „Die Forschungen zur Tierpersönlichkeit haben aber auch unsere Vorstellungen über die Wandlungsfähigkeit des Tierverhaltens in Frage gestellt. Traditionell wurde ihr Verhalten als ein flexibles Merkmal betrachtet, das je nach Situation nahezu beliebig verändert werden kann. Denn die natürliche Selektion sollte solche Tiere fördern, die sich in möglichst jeder Lebenslage optimal verhalten.“[2] Allerdings ist das nicht der Fall. Tiere behalten oft ihre Verhaltensmuster bei. Das ist damit zu erklären, dass jede grundlegende Veränderung in den Verhaltensmustern viel Energie und Zeit in Anspruch nimmt, da hierfür erst neue Neuronenverbindungen im Gehirn geschaffen werden müssen. Bezüglich dem Thema Individualität des Charakters beschreibt Sachser noch ein sehr interessantes Experiment mit Mäusen. Dabei wurden 40 weibliche Mäuse, alle mit dem exakt gleichen Genotyp, gemeinsam in ein großes Gehege mit vielen Spielmöglichkeiten gesetzt. Allen Mäusen wurde zuvor noch ein Chip implantiert, um von ihnen ein Bewegungsprofil erstellen zu können. Nach drei Monaten kam man zu dem Ergebnis, dass zu Beginn die Mäuse in ihrer Aktivität ziemlich ähnlich waren, aber mit der Zeit verschiedene Verhaltensmuster herausgebildet haben. Die einen Mäuse waren sehr aktiv und bewegten sich durch das gesamte Gehege, die anderen waren immer nur an bestimmten Orten vorzufinden und wieder andere wiesen ein Bewegungsprofil zwischen diesen Extremen auf.
Neben individuellen Charakteren verfügen Tiere durchaus über rationale Fähigkeiten. Alle Tiere können aus Erfahrung lernen. Einige sind sogar zum Planen und einsichtigen Handeln fähig. Manche, wie Menschenaffen, verfügen zudem über eine Art von Ich-Bewusstsein, was daran gezeigt werden kann, dass sie sich selbst im Spiegel erkennen. Außerdem können sie sich in ein Gegenüber hineinversetzen und erkennen, wenn dieses eventuell falsches Wissen hat, wozu ein menschliches Kleinkind noch nicht in der Lage ist. Aber besonders die kognitiven Leistungen der Vögel waren in den letzten Jahren eine Überraschung in der Forschung. Denn bisher galt in der Verhaltensbiologie das Dogma: „Die kognitiven Leistungen der verschiedenen Tierarten gehen grob gesehen mit der Größe ihrer Gehirne und dem Faltungsgrad der Großhirnrinde einher.“[3] Allerdings verfügen Vögel über keine Hirnrinde, da sie sich evolutionär anders entwickelt haben, als Säugetiere. Dennoch sind ihre kognitiven Leistungen durchaus mit denen von Menschenaffen vergleichbar. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Intelligenz sich nicht nur im Evolutionsstrang des Menschen entwickelt hat, sondern auch bei anderen Tiergruppen.
Und wie sieht es mit den Emotionen aus? Oft ist noch die Vorstellung zu finden, dass es Tieren dann gut geht, wenn ihre materiellen Grundbedürfnisse (wie ausreichend Nahrung) erfüllt, sie nicht physisch krank und zeugungsfähig sind. Alle diese Bedingungen sind mehr oder weniger auch in der Massentierhaltung erfüllt. Aber trotzdem beißen sich Schweine in diesen Haltungsbedingungen gegenseitig die Schwänze ab und Hühner picken aufeinander ein. Das deutet definitiv nicht darauf hin, dass es den Tieren gut geht. Es gibt mittlerweile etliche Versuche zu den Emotionen bei Tieren. Beispielsweise versetzt man sie in Situationen, die bei uns Menschen eine bestimmte Emotion auslösen würde, und beobachtet die Reaktionen der Tiere. Dabei haben sie Verhalten gezeigt, welches auf unter anderem Angst, Wut, Trauer, Eifersucht und Frustration hindeutet. Bei solchen Analogieschlüssen muss man allerdings vorsichtig sein, da sich manche Emotionen bei Tieren anders äußern. So scheinen Delphine immer zu lächeln, was aber nicht bedeutet, dass sie immer fröhlich sind. Ihr Gesichtsausdruck ist lediglich der Anatomie ihres Kiefers und der mangelnden Gesichtsmuskulatur verschuldet. Was das Wohlbefinden der Tiere angeht, gibt es mittlerweile sogenannte Präferenztests, bei denen sie zwischen mehreren Alternativen wählen können. Wobei hier auch wieder Vorsicht geboten ist, da Tiere auch nicht immer unbedingt das langfristig Beste für sich wählen. So ziehen viele Ratten Alkohol Wasser vor. Evolutionär gesehen ist es vollkommen plausibel, dass Tiere über Emotionen verfügen. Denn der Teil des Gehirns, wo Emotionen erzeugt werden, das limbische System, ist eine sehr alte Struktur, die bei allen Wirbeltieren zu finden ist.
Das bedeutet zusammengefasst: Tiere haben Emotionen, eine gewisse Rationalität, einen individuellen Charakter und sind nicht genetisch vollständig determiniert. Aber stimmt das Bild, von den altruistischen und aufopferungsvollen Tieren, die die „besseren Menschen“ sind? Genau genommen nicht; es wird zwar von Freundschaften und altruistischen Handlungen unter beispielsweise Affen und Fledermäusen berichtet. Diese basieren jedoch oft auf dem Prinzip „eine Hand wäscht die andere“. Meistens geht es Tieren um die möglichst häufige Weitergabe ihrer eigenen Gene. Deshalb verhalten sie sich vielleicht gegenüber ihren Verwandten altruistisch, aber es kommt durchaus zur Tötung von Artgenossen. Wenn beispielsweise ein Löwenmännchen neu in ein Rudel kommt und sich gegen den bisherigen Anführer behaupten kann, tötet es die Jungen seines Vorgängers, damit die Weibchen schneller wieder zeugungsfähig sind.
Das Buch der Mensch im Tier widerlegt somit die Vorstellungen vom Tier als Maschine oder als besserer Mensch. Auch wenn hier keine ethischen Fragen gestellt und beantwortet werden, ist das Buch als Denkanstoß sehr interessant. Es gibt einen groben und gut verständlichen Überblick über die aktuellen Ergebnisse und Forschungsfelder der Verhaltensbiologie, die zeigen, dass wir Tiere deutlich differenzierter betrachten müssen, als wir es bisher getan haben.
[1] Sachser 2018, 15f.
[2] Sachser 2018, 196.
[3] Sachser 2018, 163.
Bild: Pixabay