Bild: Thomas Grams from Unsplash.
Moderne Gesellschaften bieten keinen übergeordneten allgemeinen Lebenssinn. Regierungen sind dagegen weitgehend machtlos. An die Stelle allgemeiner Sinnkontexte treten autonome Sinninseln. Wem es nicht gelingt, sich einer passenden Sinninsel anzuschließen, bleibt auf der Strecke.
In der letzten Lagebesprechung habe ich das Problem untersucht, dass Menschen trotz gut gefüllter Konten unglücklich sind. Das passiert, so habe ich argumentiert, wenn unsere höheren Bedürfnisse, etwa nach Anerkennung oder Transzendenz, nicht befriedigt werden. Als Konsequenz nehmen wir das Leben als unerfüllt und sinnlos wahr. Dieses Problem erscheint in liberalen, modernen, „großen“ oder „offenen“ Gesellschaften besonders drängend: Denn einerseits sind die Angehörigen dieser Gesellschaften materiell meist so gut versorgt, sodass sich die Befriedigung höherer Bedürfnisse umso stärker aufdrängt und jeder Mangel in dieser Hinsicht umso deutlicher auffällt. Andererseits ist es, wie der Historiker Joachim Fest in Die schwierige Freiheit notierte,
„der große, gleichsam angeborene Mangel liberaler Gesellschaften, daß sie keinen greifbaren, die Leiden und Ängste der Menschen rechtfertigenden Lebenssinn vermitteln. Auch halten sie keinen mobilisierenden Zukunftsprospekt bereit und werfen den Einzelnen auf lediglich das zurück, was er als individuelle Erfüllung begreift.“
Doch wenn diese Einzelnen in ihrem Leben eben nichts mehr als „individuelle Erfüllung“ erfahren, stehen sie über kurz oder lang vor der kompletten Sinnlosigkeit. In dieser Situation befindet sich der Protagonist des Romans „Serotonin“. Und insofern Literatur als „Kondensation der Wirklichkeit“ aufgefasst werden kann, ist es die Situation freier, materiell reicher, aber zunehmend sinnarmer Gesellschaften überhaupt.
,Sinn‘ soll hier streng als ,Lebenssinn‘ verstanden werden. Die hier vorgebrachte Argumentation stützt sich dabei entscheidend auf die Annahme, dass das Individuum einen solchen Lebenssinn nicht einfach aus sich selbst heraus produzieren kann, sondern vielmehr darauf angewiesen ist, sich innerhalb einer Gemeinschaft und einem Geflecht aus geteilten Werturteilen und Überzeugungen zu orientieren. Aus diesem Geflecht, das ich als Sinnkontext bezeichnen will, lässt sich der individuelle Lebenssinn herausdestillieren, und nur innerhalb eines solchen Sinnkontextes kann er sich weiter entfalten und erhalten.
Wenn es heute scheinbar so schlecht um den Sinn bestellt ist – warum soll es früher einmal besser oder zumindest anders gewesen sein? In den noch relativ hierarchischen, geschlossenen Gesellschaften der Vergangenheit können gewisse allgemeine Sinnkontexte angenommen werden: etwa eine einheitliche Religion; die einheitliche Treue zu einem Herrscher oder Fürsten; später noch die gemeinsame Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat. Die in der Lebenswelt präsenten Symbole dieser Religion, dieses Herrschers oder dieser Nationen erinnerten dabei jederzeit an die geteilten Werturteile und Überzeugungen. Die Messen und Kruzifixe, die Wappen, Flaggen, Nationalhymnen und Militärparaden wiesen die Einzelnen jederzeit auf den allgemeinen Sinnkontext hin,in den sie eingebettet waren und innerhalb dessen es für jeden und jede möglich war, den eigenen Platz zu erkennen und den Sinn der eigenen Existenz definitiv zu beschreiben. Definitiv, weil an diesem individuellen Lebenssinn kein Zweifel mehr aufkommen konnte, sofern nicht auch an der jeweiligen Religion, dem Reich oder der Nation gezweifelt wurde.
Vor diesem Hintergrund habe ich mich lange gefragt, wie eine derartige allgemeine Lösung, die als Religions- oder Nationsersatz herhalten könnte, unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen erreicht oder re-produziert werden könne. Der Hauptkandidat, den ich im Sinn hatte, war eine Art gesellschaftlich koordiniertes Zusammenspiel von kollektiven und individuellen Akteuren – das heißt von Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Vereinen, lokalen Communitys und den sich darin und zwischen ihnen bewegenden Individuen – ein Zusammenspiel, das darauf abstellt, für die Individuen das Maximum an Sinn zu ermöglichen, indem es sie in einen umfassenden, die voneinander abgetrennten Lebensbereiche durchdringenden und transzendierenden Sinnkontext einbettet. Diese Sichtweise betrachte ich inzwischen als verfehlt. Stattdessen nehme ich an, dass ein solcher allgemeiner Sinnkontext nicht möglich ist, ohne die Vielfalt der Lebensstile, -welten und der gesellschaftlichen Funktionssysteme zu zerstören und damit letztlich in eine hierarchische, autoritär organisierte Gesellschaft zurückkehren zu müssen, in denen ein mächtiger Akteur den übrigen Akteuren einheitliche Werturteile und Überzeugungen aufdrücken kann, die lokal höchstens graduell angepasst und interpretiert, aber nicht verändert oder verbessert werden können. Dazu müsste es unter heutigen Bedingungen etwa eine Art Superministerium für Sinn geben, das in alle genannten Bereiche hineinregulieren und die lokalen Ressourcen zur Ermöglichung von Sinn beziehungsweise zur Generierung von Sinnkontexten heranziehen kann. Dass das möglich sein soll – die Akteure planmäßig und von außen dazu anzuregen, Sinn zu ermöglichen – halte ich unter den gegebenen Umständen für unmöglich.
Abgesehen von den enormen Kosten eines solchen Unterfangens: Die meisten konkreten Maßnahmen, etwa eine täglich zu singende Schul-, Universitäts-, Büro- oder Betriebshymne, würde dem allgemeinen Sinnverlust keineswegs entgegenwirken; sie würde ihn eher verschlimmern, weil uns ein von außen kommender Zwang, diese Rituale auszuüben, ihre Entleertheit nur umso deutlicher vor Augen führen würde. Ein allgemeiner Sinnkontext lässt sich unter heutigen Bedingungen jenseits solcher alberner Visionen nicht beschreiben, weil er in Gestalt gemeinsamer Werturteile und Überzeugungen nur als eine Art Minimalkonsens über allgemeine und öffentliche Fragen – über Fragen der Demokratie, des Rechts, der Wirtschaftsordnung und so weiter – bestehen kann, die Fragen des individuellen Lebenssinns jedoch letztlich offenlassen muss. Einer ehrlichen Analyse der Lage muss es deshalb vor allem um die Anerkennung gehen, dass uns der der Weg zurück zu irgendeinem allgemeinen Sinnkontext versperrt ist beziehungsweise eine solche Rückkehr nur um den Preis der gesellschaftlichen Degeneration und einer praktisch nur gewaltsam herbeizuführenden Rückkehr in eine geschlossene, strikt hierarchisch organisierte Gesellschaft zu haben wäre. Die Vielfalt der Lebensstile- und -welten – die kleinen und großen Unternehmen, städtischen und ländlichen Lebensstilen, Dialekte, Slangs, Jargons, Hobbys, Subkulturen und so weiter – so stark zu reduzieren, dass ein allgemeiner Sinnkontext wieder möglich ist, würde sich korrumpierend auf das gesamte System auswirken, und dann umso weniger zum individuell erlebten Sinn beitragen.
Wenn diese Feststellung nicht in totale Resignation münden soll, drängt sich die Frage auf: Wenn nicht durch allgemeine Sinnkontexte, wie ist in modernen Gesellschaften Sinn überhaupt möglich?
Die hier vertretene Antwort lautet, dass die Stelle der allgemeinen Sinnkontexte in modernen Gesellschaften zunehmend autonome Sinninseln einnehmen: lokale, nicht-allgemeine Sinnkontexte. Damit meine ich etwa bestimmte abgetrennte Lebenswelten oder die Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen, Clubs und Milieus (statt großen Staaten, Religionsgemeinschaften oder Städten). Diese Inseln – beispielsweise das Unternehmen Google, die EU-Kommission und der FC Bayern München – stehen unter Umständen in keinem oder nur losen Kontakt zueinander. Dabei sind nicht nur fehlende sachliche Bezüge, sondern auch mangelnde lebensweltliche Berührungspunkte gemeint. Im Bezug auf Werturteile, Überzeugungen, Lebensstil, Interessen und so weiter bestehen zwischen den Angehörigen dieser Sinnkontexte unter Umständen kaum noch Gemeinsamkeiten, die über öffentliche Fragen hinausgingen (und nicht einmal das muss der Fall sein.) Innerhalb dieser lokalen Sinnkontexte beziehungweise Sinninseln lässt sich noch immer ein Sinn finden und beschreiben. Er lässt sich jedoch nicht in jedes Vokabular, in dem andere Sinninseln ihre Sinnkontexte, das heißt ihre geteilten Werturteile und Überzeugungen formulieren, übersetzen, ohne dabei einen Sinnverlust in Kauf zu nehmen. Zwischen den einzelnen Sinninseln herrscht ein zunehmendes Maß an Inkommensurabilität. Was der sogenannte Normalbürger als sinnloses Datensammeln, sinnloses Profitstreben und sinnloses Globalisierungsbefeuern wahrnimmt, sieht ein Google-Mitarbeiter wohl eher als das historisch beispielloses Unterfangen, die Informationen der Welt allen Menschen zugänglich zu machen, starkes Wachstum zu erzielen und die Menschen und Kulturen der ganzen Welt immer näher zusammenzubringen.
Die Inkommensurablität an sich ist im Vergleich zu den teilweise erheblich kleineren, aber ebenso strikt voneinander getrennten Sinnkontexten vormoderner Gesellschaften nichts wirklich Neues. Zwischen den Untertanen eines deutschen Kleinkönigs im 13. Jahrhundert, französischen Händlern und zeitgenössischen arabischen Gelehrten dürfte eine vergleichbare oder noch drastischere Inkommensurabilität geherrscht haben, und in öffentlichen Fragen dürfen diese Gruppen noch deutlicher auseinandergelegen haben. Bemerkenswert daran ist, dass das Weiterbestehen solcher Inkommensurabilitäten die Tendenz moderner Gesellschaften, zu wachsender Vereinheitlichung und Konvergenz – Gleichheit vor dem Gesetz, einheitliches Recht in immer größeren Gebieten, gemeinsame Währungsräume, konvergierende Präferenzen für Konsumgüter, wenige, weit verbreitete Verkehrssprachen – konterkarieren. Während die Gesellschaften immer größer und die öffentlichen Institutionen immer ähnlicher oder zumindest kompatibler werden, gilt das nicht für die Sinnkontexte. Zugespitzt gesagt: Öffentliche Fragen werden weltweit immer gleicher, private Fragen immer unterschiedlicher beantwortet. Indem sich die Öffentlichkeiten ausdehnen oder zusammenwachsen, bleiben die Privatbereiche strikt getrennt oder fallen sogar weiter auseinander, nicht aufgrund gesellschaftlicher Zwänge, sondern wegen eines Mangels an gegenseitigem Verständnis.
Welche Bedeutung diese Sinninseln nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich besitzen, lässt sich etwa anhand einer Parteiendemokratie verdeutlichen. Bestimmte Parteien beziehen sich auf bestimmte gemeinsame Werturteile, halten gewisse Probleme für wichtig und bestimmte Strategien zu ihrer Lösung für geeignet. Diese Werte und Überzeugungen bieten, gemeinsam mit den sie verkörpernden prominenten Figuren, den Ritualen und dem gemeinsamen Jargon den Sinnkontext für die Individuen, das heißt die Parteimitglieder. Innerhalb einer Partei und ihres Dunstkreises hat eine bestimmte Tätigkeit (etwa das streitbare Eintreten für Tierrechte oder die Befürwortung des Dieselmotors) einen für alle der Sinninsel Angehörigen klaren und einsehbaren Sinn, den es außerhalb dieser Sinninsel nicht unbedingt haben würde. Auch die demokratische politische Tätigkeit überhaupt kann nur innerhalb der Sinninsel der einer bestimmten Demokratie mit ihren Werten und Symbolen als sinnvoll gesehen werden: Gäbe es keine Demokratie, keine politischen Grundströmungen, keine Wahlkämpfe, keine politischen Erkennungszeichen, Parteinlogos Versammlungen, Sitzungen und so weiter, wäre es auch entsprechend unmöglich, irgendeine Arbeit für eine demokratische Partei für sinnvoll zu halten. Dabei steht nicht die politische Tätigkeit aus öffentlicher, sondern privater Sicht im Fokus: aus der privaten Sicht der Individuen, die sich irgendwann entschließen, politisch tätig zu werden. Es geht um die privat wahrgenommene Sinnhaftigkeit öffentlich immer schon als notwendig und legitim angesehener öffentlicher Tätigkeiten.
Ähnliches gilt für Unternehmen oder Bildungseinrichtungen: Ohne Zugang zu dem Sinnkontext, den diese Organisationen als Lebenswelt eröffnen, wäre ein individueller Lebenssinn innerhalb dieser Organisationen unmöglich. Wer einen bestimmten Sinnkontext ablehnt, wird darin auch keinen individuellen Lebenssinn generieren können: Wer nicht an die Wissenschaft glaubt, wird es nie sinnvoll finden, zu studieren oder an einer Universität zu lehren, und wer den Lebensstil ablehnt, zu denen ein bestimmtes Unternehmen beiträgt, indem es etwa die entsprechenden Produkte liefert oder durch sein Marketing als attraktiv darstellt, wird es nie sinnvoll finden können, für dieses Unternehmen zu arbeiten.
Diese autonomen Sinninseln sind im Vergleich zu den alten allgemeinen Sinnkontexten weniger allgemein und weniger normierend, das heißt weniger darum bemüht, individuelle und lokale Unterschiede einzuebnen. Vielmehr tendieren sie dazu, sich gegenüber anderen Sinnkontexten abzugrenzen oder zu differenzieren. Sie ermöglichen Sinn im eigenen Interesse: weil sie es müssen, damit Individuen freiwillig in ihnen agieren und sie auf diese Weise am Leben erhalten. Sinnlose Organisationen, Milieus oder Lebensbereiche tendieren dazu, einfach zu verschwinden, weil niemand gern an Sinnlosem teilnimmt. Sinnerfüllte Organisationen und Milieus sind demgegenüber lebendiger und stärker, weil sie die Menschen durch Sinnstiftung anziehen und dauerhaft an sich binden können. (Das scheint mir ein wichtiger oder sogar der entscheidende Grund für das Streben nach mehr Sinn im Wirtschaftsleben zu sein, das im Moment unter dem Begriff des Purpose Eingang in viele Unternehmen findet.)
Das beschriebene System aus Sinninseln ist für sich genommen stabil und funktioniert für die Individuen innerhalb der Sinninseln nicht schlechter als das alte System. Es erschwert vielleicht von Zeit zu Zeit die Kommunikation zwischen Individuen aus dem einen und Individuen aus dem anderen Sinnkontext über gewisse Fragen: warum sie etwa einen bestimmten Job unbedingt oder auf keinen Fall machen wollen oder eine bestimmte Politik falsch oder richtig finden. Das scheint jedoch, wenn man den Zuwachs an Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten in Betracht zieht, ein relativ geringer Preis zu sein. Die Menschen, die sich das Flaggenhissen und Hymnensingen unmittelbar zurückwünschen, scheinen in den meisten modernen Gesellschaften nicht gerade die Mehrheit zu stellen.
Problematisch ist dieses System nur für die, die nicht Teil der einen oder anderen Sinninsel sind oder die nicht oder nicht vollständig den Sinninseln angehören können, der sie angehören wollen: weil sie ihren Traumjob nicht bekommen, von der Wunschuniversität abgelehnt werden oder das Vokabular, in dem der Sinn dieser Insel formuliert wird, nicht so flüssig sprechen oder so perfekt verstehen, wie sie es müssten, um darin ihren individuellen Sinn formulieren zu können. Der alte Nationalstaat etwa hätte für diese Leute immer noch seine Hymnen und Symbole zur Verfügung gestellt. Auch Arbeitslose, Verzweifelte und Verrückte können noch mitsingen und der Militärparade zujubeln. In dem Maß, in dem diese tradierten Sinnkontexte jedoch nicht nur aus dem Alltag zurückgedrängt werden, sondern vor allem ihre Überzeugungskraft verlieren, in dem Maß verlieren auch die, die auf ihrer jeweiligen Sinninsel nicht zufrieden sind, den Zugang zu einem Sinnkontext überhaupt, der es ihnen ermöglicht, noch irgendeinen individuellen Lebenssinn zu erzeugen. Daher trifft der vermeintlich allgemeine Sinnverlust in einer offenen Gesellschaft in Wahrheit nur die, die nicht das Glück oder Geschick gehabt haben, sich einer für sie passenden Sinninsel anzuschließen: die entweder von den gewünschten Sinninseln ferngehalten werden oder an denen, in denen sie sich aufhalten, zu starke Zweifel haben.
Um zur Ausgangsfrage zurückzukehren: Im Licht dieser Analyse sind Menschen deshalb ,trotz gut gefüllter Konten unglücklich‘, weil es ihnen in der Vergangenheit unmöglich war, sich einer zu ihnen passenden Sinninsel anzuschließen, die einen für sie glaubwürdigen und annehmbaren Sinnkontext liefert, da sie den gemeinsamen Werten und Überzeugungen in diesem Sinnkontext zustimmen können. Diese Antwort scheint auf Houellebecqs Figur Florent-Claude genau so zuzutreffen wie auf die anderen literarische Klassiker der Sinnlosigkeit, etwa Meursault in Camus Der Fremde; Camus Caligula oder Dostojewskis nihilistischer „Kellerlochmensch“.
Offene oder moderne Gesellschaften sind demnach nicht genuin sinnfeindlich, sinnhemmend oder gar sinnzerstörend. Das System aus Sinninseln funktioniert für die Beteiligten nicht schlechter und in vielen Fällen sogar besser als das traditionelle System allgemeiner Sinnkontexte. Nur für diejenigen, denen es misslingt, sich einer Inseln anzuschließen, funktioniert das System nicht, für die Armen, Ausgestoßenen, und für radikale Skeptiker. (Spekulativ lässt sich damit auch die häufige Sympathie skeptisch eingestellter Intellektueller mit Menschen am Rand der Gesellschaft erklären.)
Wenn man Sinnlosigkeit als gesellschaftliches Problem ernst nehmen wollte, dürfte es demnach nicht darum gehen, einen gesamtgesellschaftlich, etwa durch öffentliche Diskurse generierten Sinn mehr oder weniger gewaltsam in die einzelnen Lebensbereiche hineinzupressen, sondern darum, einerseits die Pluralität dieser Lebensbereiche und -welten zu bewahren, bereits funktionierenden Sinnkontexte von innen heraus noch funktionstüchtiger und erfolgreicher zu gestalten, und auf der Makroebene eine Art minimalen gesellschaftlichen Sinnkontext zu generieren, der es allen erlaubt, ein Mindestmaß an Lebenssinn zu generieren und sich auf diesem Niveau zu stabilisieren. Es ginge dann, pointiert gesagt, um eine Art Sozialpolitik des Sinns. Dass etwas derartiges realisiert werden könnte, damit ist kaum zu rechnen. Unter diesen Umständen sollte man sich jedoch nicht mehr über das ,sinnlose‘ Verhalten gewisser Personen und gewisser Gesellschaften überhaupt wundern.
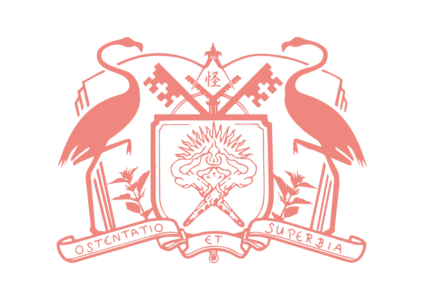
Der Beitrag gefällt mir gut…
…aber einen Gedanken möchte ich doch zu bedenken geben: Das Konzept „Sinninseln“ klingt gar nicht so un-sinnig, allerdings bezweifele ich, dass es über die theoretische Erörterung hinaus kommt.
Man wird nicht umhin kommen, in einer Art „positiver Diktatur“ eine Grundlage zu schaffen, dass so etwas wie Sinn, Lebenssinn, überhaupt denkbar – im Sinne von Grundlage einer Realisierung – wird. Positive Diktatur meint nicht zum Wohle des Diktators und seiner „Berater“, sondern zum Wohle von Gesellschaft, meinetwegen Staat, Welt… Wenn eine gemeinsame Grundlage geschaffen wurde, auf der alle leben, dann kann möglicherweise so etwas wie „Sinn“ nicht nur gedacht, sondern auch gelebt werden. Dann würde der vorstehende Beitrag nicht ganz so pessimistisch enden…
Da finde ich die Ausführungen im Artikel überzeugender, die darlegen, dass ein einheitlicher Sinnkontext für alle Menschen so nicht möglich ist. Zudem erscheint mir die Idee eines wohlmeinenden, guten Diktators, der in einer Art Allwissenheit „zum Wohle Aller“ eine Gesellschaft formt, mithin in der Lage ist, die Bedürfnisse jedes Menschen auf eine Gemeinsame Grundlage herunter zu brechen, die dann wirklich- aufgrund der außergewöhnlichen Weisheit dieses menschenliebenden Diktators- für alle als sinnhafte Grundbasis taugt, untopisch. Dazu sind die Menschen zu verschieden und allwissende, gütige Führer zu nicht-existent. Zudem ist meiner Meinung nach fraglich, ob ein vorgeschriebener Sinnkontext, wie weise der Vorschreibende auch sein mag, tatsächlich je als erfüllend im Sinne von Selbstverwirklichung erlebt werden kann.
Wir Menschen neigen leider sehr oft dazu, das, was uns nicht möglich erscheint, als utopisch zu bezeichnen und im Bücherschrank in der Ecke bei Thomas Mores „Utopia“, Francis Bacons „New Atlantis“ oder Rousseaus „Gesellschaftsvertrag“ zu verstauen.
Aber mit dem Gedanken einer Diktatur oder Weltregierung – der Gedanke „allwissende, gütige Führer mit außergewöhnlicher Weisheit“ ist mir dabei gar nicht gekommen – haben sich auch schon andere beschäftigt. Der Gedanke „utopisch“, so argumentiert zB Russell in etwas anderem Zusammenhang, geht immer von einer auf dem Wege der Verständigung zustande gekommenen „Weltregierung“ aus. Die im Kommentar dargelegte Idee beinhaltet jedoch, dass auf absehbare Zeit jede Hoffnung auf wirkliche Verständigung unmöglich ist. Wir sollten uns zu der Erkenntnis durchringen, dass das Konzept „positive Diktatur“ oder „Weltregierung“ erzwungen werden muss!
Das wirkt jetzt so, als sollte der im Beitrag erörterte Sinn für die Menschen erzwungen werden. Es geht aber darum, eine Basis zu schaffen, diesen Sinn zu verwirklichen und nicht in Resignation zu enden als „utopisch“.