Lifestyle-Bericht aus der unverschuldeten Einsamkeit
08.09.20, Meinungsinstitut
Ab wie vielen Jahren ist eigentlich Der Fänger im Roggen? Oder für wie viele Jahre gedacht? Und von wie vielen Jahren gelesen? Ich frage auch, weil coming of age sicher nicht in jedem Altersabschnitt (65+) eine Thematik von Interesse ist. Weil man eher umgekehrt aus dem Erwachsensein herauswächst. Ab einer gewissen, leidvoll verdienten Lebensklugheit, muss irre verwirrt über Sex nachdenken einfach sau anöden. Jedenfalls möchte ich loswerden: Ich bin für eine Altersbeschränkung bei Büchern (also nicht nach oben, sondern nach unten, im Sinne einer FSK). Wegen Erebos mit 11. Und ihr so?
05.09.20, Balkonien
Sommerpause vorbei, ich bin zurück. Und wir müssen reden. Weil ich auch physisch und geographisch zurück bin, also weil ich weg war, außerhalb Deutschlands, in Frankreich. Ich war 11 Tage campen, weit ab der zones rouges und mit wenigstmöglich sozialen Kontakten. Trotz dessen hege ich starken Zweifel, ob die Entscheidung, zu urlauben, überhaupt rational war, ob die besten Gründe für diesen eskapistischen Akt gesprochen haben. Denn nichts anderes war es: Eine Flucht aus dem Alltag. Ich musste raus. (Anm. d. Autors: Bitte hier über meine deterministische Formulierung aufregen. Aber nicht zu sehr, denn ich möchte ja gerade die als wahrhaftig empfundenen, scheinbar natürlich gegebenen Implikationen unserer gesamtgesellschaftlichen Auffassung von „Urlaub“ hinterfragen). Raus bedeutete für mich: Raus aus Deutschland, nicht etwa raus aufs bayerische Land, nicht raus an die Nordsee, nicht raus in den Harz. Urlaub machen geht nicht im eigenen Land. Das dachte ich mit einer beschämenden Selbstverständlichkeit – bis ich, veranlasst durch nagende Gewissensbisse, während europaweit steigender Fallzahlen tatsächlich auf eine Urlaubsreise gefahren zu sein, über das Konzept Urlaub nachdachte. Kein pathetisches Nachdenken, denn dieser Tagebucheintrag soll ja keine Werbung für die Schönheit der mecklenburgischen Seenplatte sein, im Sinne von: Erst zwischen Neustrelitz und Penzlin wird Ihnen klar, dass Urlaub auch zuhause möglich ist. Nein, ich möchte hier nur einen Gedanken teilen, und in engagierter Hoffnung ermuntern, auch selbst mal nicht-pathetisch über Urlaub als solchen nachzudenken. Das bewährte Urlaubsmodell, in jene Städte, zu jenen Sehenswürdigkeiten zu reisen, die alle sehen und bereisen wollen, hat ob der Einzigartigkeit jener Städte und Sehenswürdigkeiten durchaus seine Berechtigung. Ist aber genau genommen brutaler Humbug. Wer will schon den Stress aus dem Alltag mit in den Urlaub nehmen, nur um anschließend erzählen zu können: War zwar total überlaufen, aber mega beeindruckend … nur leider kommt das auf dem Foto gar nicht so raus? Auf den Google-Bildern ja meistens schon …
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es für irgendjemanden befriedigend ist, in einem lautstinkenden Menschensumpf den Mont Saint Michel, den Machu Picchu oder den Petersdom zu besichtigen. Wer findet während dieser Rummelatmosphäre denn zur wirklich erhofften Abwechslung? Zum Ausgleich? Zum Innehalten? Hierbei noch nicht mal mitgedacht, wie ungesund und ekelhaft das Drumherum dieser Sightseeingbesuche meist ist (Cola- und Pizzaautomaten direkt gegenüber der ehemaligen Benediktinerabtei und sehr, sehr koloniale Ähnlichkeiten, wenn ein*e peruanische*r Touristenführer*in für zwei Wochen faulen Touris sein*ihr Land oder das, was sie dafür halten, zeigen muss). Und hier sind wir auch beim Stichwort, es grüßt das K-Wort.
Das Konzept Urlaub ist durchökonomisiert. Effizienz und Geld haben Erholung und Neugier den Rang abgelaufen. Dazu kommt noch, dass all die beliebten Urlaubsziele mit der Zeit durch Hektik und Massen in ihrer Form hässlicher werden. Sie nutzen sich in ihrer einzigartigen Schönheit ab, bis diese irgendwann ganz verloren geht. Wer jetzt noch nicht in Neuseeland war, hat einfach Pech. Aber wie besser machen?
Hier der konstruktive Nudge: Einfach mal den Gedanken zulassen, dass eine Urlaubsreise innerhalb Deutschlands oder gar ein zuhause verbrachter Urlaub, in der unmittelbaren Nähe des eigenen Wohnorts, schön sein kann. Und dazu noch billiger, sowie mensch- und naturschonender. Auch wenn das jetzt fast danach klingt, dieser Text ist immer noch keine Werbung für die mecklenburgische Seenplatte, nur eine Erinnerung, dass Auslandsreisen kein f*cking Menschenrecht sind. Schon gar nicht während einer Pandemie.
03.08.20, Sessel
Markus Gabriel hat gestern in einem Interview mit der Zeit ziemlich scharfsinnig darauf hingewiesen, dass I can’t breathe wohl das sprachliche Bild unserer Gegenwart sei. Eine Art Überschrift für 2020. I can’t breathe als Conclusio dreier weltbetreffender Katastrophen, die in sprachlich-semantischer Analogie auf einen Nenner gebracht werden: Die nicht erst seit diesem Jahr, nun aber öffentlich und mit mehr Schlagkraft ausgetragene Forderung nach sozialer Gerechtigkeit für schwarze Menschen, die anhaltende und Tag für Tag gravierendere Klimakrise und SARS-CoV-2, ein Atemwegsvirus. Verschleiert, verursacht, begünstigt durch das „kapitalistische Ausbeutungssystem“. We can’t breathe right now. Und das ist kein Zufall.
Gabriel ist in dem Interview kein bequemer Elfenbeinturmpessimist, er erhärtet stattdessen die These, dass nicht alles verloren, dass moralischer Fortschritt möglich ist. Wegweisend für eine moralischere Zukunft soll die Erkenntnis sein, die wir hatten, als wir in den Anfängen der Pandemie innehalten mussten. Als wir auf uns zurückgeworfen waren. Die Erkenntnis, dass uns das System Turbokapitalismus die Luft zum Atmen nimmt. Und wir uns damit Leben und Zukunft, wenn wir weiterhin gehetzt überkonsumieren, auf Kosten anderer leben und trotz dessen wegschauen. Normaüberschrift für 2021: Hinschauen, entschleiern, mal verzichten, um nicht zu ersticken.
27.07.20, YouTube
Wer um alles in der Welt hat sich einfallen lassen, den Werbespot für das Barilla (Masters of Pasta) Pesto alla Genovese musikalisch mit dem Sirtaki zu übermalen? Wirklich eines der wenigen Motive der Musik– und Tanzgeschichte, das jedes Kleinkind bombensicher benennen, oder mindestens mal in eine Art Griechenlandecke stellen kann. Ich fordere Entschädigung fürs heimtückische Auf-den-Kopf-stellen meines eigentlich zuverlässigen kulinarischen Assoziationsnetzwerks. Pestonudeln, die nach Kalamata Oliven, Feta und Finanzproblemen schmecken, sind die Vorstufe zu Nutellasuppe und Gummibärchen mit Senf. Danke für nichts, ihr Masters of Disaster.
PS: Hoffentlich reicht das hier für Twitter-Feuilleton. ^^
Und wenn nicht, dann hier der offizielle Verweis auf die online–Produktbeschreibung von Barilla: „100% italienische[s] Basilikum – im Morgengrauen geerntet.“
23.07.20, Schlosspark Suresnes
+++ Breaking: Lifestyle wird gerade auserzählt und in unangenehm idyllischer Schlossparkatmosphäre ausgelebt: woke, existenzialistisch, mondän. +++
Verehrte Leser*innen,
für Sie bin ich bis halb sechs wach geblieben, habe meine kolumnistische Unabhängigkeit aufgegeben, um den Funzel-Kosmos durchdringen zu können, habe getanzt, gelacht, mich als teilnehmender Beobachter der Soirée samt Gartenlesung, Raketenumschau und Wurstsalatbuffet hingegeben, die Nacht umarmt und mich am nächsten Morgen gleich nach der ersten Kalebasse hingesetzt und fünf Minuten automatisch geschrieben. All das, nur für Sie. Und für den Versuch, dem Lifestyle und dessen gestriger Party revueschreibend gerecht zu werden. Ein Abend in Zitaten.
„Prahlerei und Hochmut. I like.“
„Also Baby, komm und tanz mit mir. Baby. Komm. Tanz. Mit. Mir.“
„Eine Achterbahnfahrt, bei der es immer nur bergauf geht.“
„Oh. Du auch hier.“
„Zwei Weißwein und ein Wasser für 5 €? Dann gerne drei davon.“
„Let’s talk about proof theory.“
„Wir müssen uns der kapitalistischen Realität stellen. Les mal Hayek.“
„Wenn’s nicht weh tat, war’s nicht gut.“
„Wie ein Kurzurlaub auf Mykonos, nur mit fürstlicherer Prominenz.“
+++ Breaking: Fuenfte Ausgabe. Kaufen. Schnell. Gibt auch Merch. +++
21.07.20, Schreibtisch, leider
45 Minuten vor dem offiziellen Beginn der heutigen Onlineklausur, liegt eine Email in meinem Postfach – mit Hinweis, bei Wunsch und Möglichkeit bereits anfangen zu dürfen. Ich gerate daraufhin nicht etwa in nervöse Anspannung, ob des jetzt sofort möglichen Starts, sondern konträr dazu breitet sich in mir eine müde Trägheit aus, der ich normalerweise zwischen Aufstehen und Müsli anheimfalle. Ich reiße meine Fenster auf, koche Tee und putze vor dem Flurspiegel meine Zähne. Noch 32 Minuten bis zum offiziellen Beginn, es ist jetzt 15:43.
Ein erster Versuch, meine Verhaltensreaktion zu deuten, scheitert. Ein zweiter glückt: Nicht nur, dass die gruppendynamisch induzierte Hibbeligkeit heute wegfällt, da ich für mich alleine an dem Schreibtisch, den ich die letzten Wochen und Monate viel zu selten verlassen habe, diese Prüfung samt ihrer Begleitzustände durchleben muss. Nein, vor allem das Ausbleiben der gewohnten Fremdbestimmung in Drucksituationen führt dazu, dass ich nicht hochfahren kann. Noch 7 Minuten. Dass meine angewöhnte Reaktion auf die einsetzende Gewissheit «Jetzt geht’s gleich los…» durcheinander kommt. Wo sonst kaltschweißige Nervosität einen inflationären Ausbruch an Adrenalin begleitet, ist heute nichts als Morgenruhe. Niemand sagt mir, wann genau, an welchem Ort und in welcher Hose ich heute zu leisten habe. Als ich dann zwei Minuten vor eigentlichem Beginn die Klausur starte, ist da weiterhin Leere. 15 Minuten starre ich auf die erste Frage, bis ich ahne, dass gleich sowas wie Konzentration möglich sein wird. Nach Abgabe der Klausur dämmert mir, dass wohl neben dem Gefühlslabyrinth, das man vor Prüfungen gemeinsam durchgeht, auch die scheinbar entlastende Fremddelegierung (meine) maximale Leistungsfähigkeit bedingt. Ob durch ein Mehr an verfügbaren kognitiven Ressourcen oder eher dank eines Gefühls sorgloser Aufgeräumtheit, weiß ich auch nach einem dritten Deutungsversuch nicht zu sagen.
18.07.20, Tram
Heute mit A. ein halbes Billyregal in der Tram transportiert. Beim Einstieg enervierte Blicke des Fahrers mit siegesgewissem Lächeln erwidert, denn: Wir dürfen das.
«Legen sie bitte den Schrank oder was das ist auf den Boden». Natürlich. Wir stellen das Bücherregal über dem Gelenkteil ab, aus tüftlerischem Interesse. Passiert aber nix, quietscht nicht mal. Nach meinem letzten Partikularumzug mit den Öffentlichen weiß ich, dass es durchaus lohnt, sich vorab offensiv bei allen Mitreisenden zu entschuldigen. Für die Umstände. Aber dieses Mal kann sich mein verbindliches Präventiv-Sorry nicht bewähren, denn: Es sitzen nur ein paar u30er in einem Vierer vor uns. Und die gratulieren uns ganz gegenteilig mit aufgerissenen Augen und mutmaßlichem (weil AHA) Lächeln zu unserem klischee-studentischen Akt. «*grins*, voll cool». Weiß jetzt auch nicht, wie ich das finden soll, in einer Stadt zu leben, in der ein Ikearegal in einem Straßenbahngelenkwagen Grund genug ist, vom eigenen Handy hochzublicken.
Lesen Sie auch: MVG > Tickets und Tarife > Sonstige > Mitnahme von Tieren und Sachen.
04.07.20, Stadion
Kaum etwas löst so zuverlässig ergriffene Rührung und ehrlich emotionale Anteilnahme bei mir aus wie fußballtragische Erfolgsgeschichten. Mögen sie noch so sehr vor schnulzigsten Drehbuchkatastrophen strotzen oder vor romantischer Verklärung triefen. Mir zieht’s den Stecker.
So auch heute. Würzburg liegt 1:2 hinten, die Nachspielzeit bricht an, und es bedarf nur eines mickrigen Tores für den Direktaufstieg in die zweite Liga. Kraft- und ideenlos wirkt der Versuch, irgendwie Richtung gegnerisches Tor zu gelangen. Hier würden jetzt bangende und trotz oder gerade deshalb frenetisch schreiende und das Team dadurch nach-vorne-putschende Fans helfen. Doch die hocken pandemiebedingt daheim. In der flyeralarm-Arena herrscht stattdessen Stille, die erbärmliche Tristesse einer besseren Sportanlage. Die Hoffnung schwindet mit den stetig weitertickenden Schlusssekunden, bis auch der letzte und optimistischste Würzburgfan aufgibt, resigniert.
In der dreiundneunzigsten Minute schießt der Kapitän und Wortführer der Würzburger Kickers einen Handelfmeter halbhoch, den Torwart verladend, rechts ins Eck.
Ekstase. Aufstieg. Es jubeln, feiern, weinen 40 Männer und Frauen in der Mitte des Platzes. Ringsherum niemand und trotzdem scheint es das Wichtigste, sogar das Schönste zu sein, was gerade auf der Welt passieren kann. Es musste so kommen. Oh, wie ist das schön.
Als Glückseligkeit und Euphorie abklingen, meldet sich eine leise, spielverderberische Ratiostimme zurück. Prompt gruselt es mir wieder vor dieser unkontrollierbaren Reiz-Reaktions-Beziehung zwischen mir und dem Fußball. Vor allem, weil mich das Geschäft drumherum so anekelt (Goldsteak, Restart trotz Pandemie, Tönnies, usw. usf.), ich gerne über alle ungesunden und unmenschlichen Auswüchse des eigentlich so nahbaren, puren und deshalb schönen Volkssports erhaben wäre. Mir nur die kindliche Liebe für den eigentlichen Kern eines mittlerweile skrupellosen Wirtschaftsmonsters bewahren möchte.
In meiner Lebenswelt ständig mit voguer Fußballignoranz konfrontiert (Ich schau nichtmal WM), verurteile ich mich für mein emotionales Ausgeliefertsein an den Fußball. Jedoch sucht meine Rührung nach Erklärungen. Und ich muss anerkennen, dass Fußball mich wie nichts anderes in meiner Kindheit beschäftigt hat; es Zeiten gab, in denen ich meine Paninistickeralben täglich durchblättern musste. Und auch heute noch weiß ich meist circusreif und wahnsinnig treffsicher aufzusagen, wer wann wohin und wieso gewechselt ist. Fußball ist mehr als nur Trash-TV am Abend zum Ausbalancieren der eigenen Academiablase, Fußball ist mehr als ein inkonsequentes Laster, das man auf WG-Parties für sich behält. Fußball ist eher wie der versoffene und teils frauenfeindliche Onkel Paul, den man seit Kindertagen ins Herz geschlossen hat und einfach nicht mehr rauslassen kann. Weil man zu viel gemeinsam durchgestanden hat. Und weil er erst seit ein paar Jahren so ist, also nachdem er von Tante Mareike für einen anderen verlassen wurde. Vermutlich wegen Geld.
30.06.20, Isar
Henkerstext? Anders überlegt, weil Nachtschreiberei momentan läuft und ich nicht glaube, dass man besorgte Akademikerjungeltern in Jack Wolfskin Jacken, die ihre Doppelnamenskinder über den Spieli hetzen, als Abgefuckte Snobs verachten darf, wenn man sich isarabgewandt im Schneidersitz tuschelnd ein zweites Jever Fun genehmigt.
25.06.20, Zimmer
Hier der Henkerstext, bevor ich mich in die Flut an Klausuren stürze.
Ich lese gerade Holzfällen von Thomas Bernhard, höre dabei Ginseng Strip 2002 von Yung Lean in Dauerschleife und versinke mehr und mehr in einer Mélange aus Cloudtrance und Ohrensesselgemütlichkeit. Mir weiterhin unklar, wie mir das a) gelingen und b) gefallen kann, v. a. die musikalische Übermalung, da ich auch noch nie Yungs oder Lils gehört habe. Zur Rhythmik der bernhardschen Seitensätze würde sowieso jede andere Musikart besser passen, vielleicht ausgenommen Metal und Reggaeton.
23.06.20, ICE
Mir geht’s schlechter als gut und besser als schlecht. Ich bin d’accord.
19.06.20, Röhre
Massiver Verdacht auf Meniskusriss. Beim Basketballen fremdgefüßelt, dann umgeknickt. Tags darauf versichert mir ein jovialer Unfallchirurg, er würde mich wieder reparieren. «Ich mach hier und da einen Schnitt, dann klapp ich den Meniskus ausm Gelenk und fertig» erklärt er mir, während er mit einem frisch desinfizierten, hellblauen TK-Kuli in einer Knieabbildung aus der Mitnehmbroschüre kritzelt. Ich kann trotzdem nicht erkennen, ob mein innerer oder äußerer Meniskus betroffen sein soll. Auf meine Nachfrage hin, kurze Stille, seine Antwort erst jugendlich-cool, dann martialisch: «Same same but different, ich schick dich in die Röhre, dann wissen wir, wo der Feind sitzt.»
Nachdem ich in die Radiologie gehumpelt bin, im Wartezimmer saß und endlich aufgerufen wurde, folgt dieser schlimmste Moment des geduldigen Patient*innendaseins. Ich sitze halbnackt und einsam auf einer kalten Hartplastikbank in der Schleuse zum Saal mit den Tomografen. Ohropax rein, denn ein schnödes Schild neben der Türe weiß: «Es wird SEHR laut.» Du kommst heut noch auf den Tisch. Ich werde dich reparieren. Angst.
Fünfzehn Bärenminuten später dann folgende Erkenntnisse: Meine SS ist ein Anagramm für Siemens. Für Anagramm gibt es kein Anagramm. Fleischi hört bei Bayern 3 auf. Wirklich SEHR laut. Zurück in der Orthopädie folgt ein Plottwist à la Usual Suspects: Entwarnung. Die Bilder zeigen nichts, beide Menisken sind heile. «Das glaub ich nicht, aber sei froh.» Mittlerweile also beim Du. Die Notfallop sagt er ab, klatscht mir einen walnussgroßen Batzen Salbe aufs Knie und hält mir zum Abschied eine Ghettofaust mit Ehering hin. Kein Eingriff, aber auch keine Diagnose, nur die absurden Schmerzen bleiben. Different but same same.
16.06.20, Wald
Albtraum gehabt: Philipp Amthor ist mein Großvater. Also der Aussehensamthor. So mit Frack, Scheitel und Jägerblick. Wohingegen der Aktienamthor aktuell unter verbalem Hausarrest steht, nach seinem jugendlich-naiven Ausrutscher. Ach, das kann mal passieren, so ein Sufftattoo oder ne fette Beule in Papas Karre, alles halb so schlimm. Jung und wild, da unterlaufen halt Fehler.
Ich würde genau hier ansetzen, wie alle, die jetzt umso lauter ein Lobbyregister fordern, wie alle, die Amthor nicht ohne Konsequenzen davonkommen lassen wollen, wie alle, die anprangern, dass ein Fehler doch eine Abweichung vom eigentlich Richtigen, also der vernünftigen Norm ist und deshalb die Beschreibung von Amthors Verhalten als eben solcher ganz und gar fehlerhaft ist. Denn Amthor ahmte nach, wiederholte, reproduzierte giergeile Parteipraktiken, um wie die Großen der eigenen Karriere monetäre Relevanz und Machtaussichten zu verschaffen. Kurz: Er hielt sich an die Norm.
Genau da würde ich ansetzen, wenn es mich nicht so furchtbar anöden würde, wenn mir nicht so glasklar wäre, dass am Ende keine Änderung, sondern nur ein neues Label stehen wird. Dafür sorgt schon der auf Amthor gerichtete Scheinwerfer, während sich hinter der Bühne zukünftige Nebentätigkeitsaffären mit neuen Kostümen auf ihren Auftritt vorbereiten.
10.06.20, Zimmer
Post-It Weisheit Nummer 7:
«Alles braucht Zeit.»
Stimmt, weitermachen. Aber:
Ikearegal zusammenschrauben, die täglichen 30 Seiten lesen, Kochidee eruieren, kochen, von A-nach-B-kommen. Wirklich alles braucht seine Zeit. Und ziemlich immer dauert es länger als vorher ausgemalt. Zwei statt einer Stunde, 50 statt 30 Minuten, sechs statt zwei Chefkochseiten, vier statt zwei Pfannen und vergiss es, wie viele Platten ich dieses Jahr schon hatte (5!!!!!).
Das Hinterhältige an dieser lapidar daherkommenden Erkenntnis ist doch, dass sie überhaupt nicht anhält. Nie zu Verhaltensänderung anregt oder gar motiviert. Gerade belächelt man noch die Kleingeistigkeit dieser Zeilen und im nächsten Moment: Schwupps, ich wollte doch nur mal kurz die Funzel checken, bevor ich wieder weiterarbeite. Genau, nur kurz. Damit fängt der Kreislauf des Vergessens ja jedes Mal aufs Neue an. Und man werkelt, kocht, denkt, radelt drauf los und ärgert sich notwendigerweise hinterher, verflucht die Eltern, die das schon immer gesagt haben. Doch wenn man die Einsicht ernst nimmt, sie schaut, dann kann man dabei mal die eigenen, strengen Erwartungen an sich und andere hinterfragen. Alles (ver)braucht Zeit. Und damit auch Energie und Kapazitäten.
Vielleicht muss das nicht nur ernüchternd, sondern kann auch dienlich sein. Zum Beispiel als erwartungsregulierender Maßstab. Oder als Defaultausrede Number One.
02.06.20, Englischer Garten
Grundsoliden Sommertag verbracht. Erst mit VVV und K. Ćevapčići essen gewesen, dann bei einem Kaffee in der Sonne über Lolita (Buch), Eloquent (Rapper) und die Falklandinseln unterhalten. Spätnachmittags noch in Eisbach gesprungen. Corona wer?
Doch es bleibt ein Rest schlechtes Gewissen, trotz Grundgefühl, sich ein bisschen Sommernormalität verdient zu haben.
29.05.20, Café
Für das beginnende Wochenende sind wieder Anti-Corona-Demos angemeldet. Insgesamt werden mehrere Zehntausend erwartet; in Stuttgart, München, Berlin, Frankfurt. Hallo, bei aller demokratischen Vernunft und grundgesetzschützenden Bürgerpflicht (hierfür am besten A duty to protest in times of Corona lesen), irgendwie haben diese Protestkundgebungen ein komisches Gschmäckle. Und das nicht nur wegen Stuttgart.
Nachdem Attila Hildmann (Paranoiakoch und -kumpel von Xavier Naidoo) auf einer Demonstration in Berlin festgenommen wurde, musste ich an eine Formulierung von Niklas Luhmann denken: „Gegen Komplexität kann man nicht protestieren.“ Hübsches Zitat, logisch. Doch da ist etwas, das es aufzudröseln lohnt. Proteste sind gegen oder für, anti oder anti-anti, nein oder ja zu Atomkraft, Griechenlandkrediten und Grundeinkommen. Diesem dichotomen Muster liegt manchmal eine Schwarz-Weiß-Sicht auf die Welt zu Grunde, die dann eben nur entweder … oder zulässt. Keine zusammenhängenden Cluster aus Ursache, Einfluss und Wirkung. Kein Grau.
Eine die besten Argumente abwägende, unübersichtliche Kausalgeflechte miteinbeziehende und sich stetig informierende Überzeugung lässt sich schwierig durch Demos und Proteste katalysieren. Deshalb: Welt plattwälzen, in so-oder-so-nicht-Schemata pressen und Hauptsache laut. Das ist sicher manchmal notwendig, kann die Politik überzeugen, Debatten anregen und die Titelblätter füllen. Aber Proteste sind oft genug kein adäquater Ausdruck differenzierter Meinungen. Obwohl diese so bitternötig wären. Für all die gesellschaftsrelevanten Debatten, die immer seltener geführt werden. Also Protest und komplexe Welt, das haut nur bedingt hin.
Nun lässt sich das Luhmannzitat aber noch ein wenig spezifischer, ja aktualitätsbrisanter deuten. Ein wenig mehr in Bezug auf Attila Hildmann und sogenannte Verschwörungstheorien. Sogenannt und kursiv deshalb, weil jene verschwörungsbeherbergenden Denkversuche viel eher Musterbeispiel falsifikationsimmuner Pseudotheorien sind. Naja. Anhänger*innen dieser Verschwörungskomplotte, welche einen nicht unerheblichen Teil der Anti-Corona-Demonstrierenden stellen, finden aber grobe Vereinfachung komplexer Umstände und noch so krude Systeme, in denen auf wundersame Weise alles ganz leicht verdaulich und einfach zu sein scheint, gut. Weil sie diese Systeme nicht schlecht finden, finden sie sie gut, also nicht-schlecht. Verschwörungsglaubende leugnen die Komplexität der Welt. Und protestieren trotzdem. Oder deswegen.
Bonmot zum Schluss: Die Gewissheit der Tatsache, in einer komplexen, wahrscheinlich niemals in Gänze verstehbaren Welt zu leben, ist wohltuend. Und sich manchmal dummfühlen ist Teil der Einsicht.
09.05.20, Küche
Habe die leise Vorahnung, dass mein Geburtstag in zwei Tagen wegen sich häufender Kopfschmerzen (meinerseits), Coronakrise (allerseits) und miesem Regenwetter (scheiße) ein wenig untergehen wird. Vor einem Jahr hätte mich das sicherlich gestört. Gedanke zu Kopfschmerzen: Muss wohl von dem ständigen Bildschirmgestarre kommen. Online-Uni fürn Arsch. Gedanke zu Coronakrise: Warum nach fünf Monaten immer noch von Krise reden? Mein Vorschlag: Mal wieder etymologisch rückbesinnen. Immerhin bedeutete Krisis mal Entscheidung beziehungsweise entscheidende Wendung. Ich werde jetzt nur noch zuhören, wenn jemand von Coronasituation spricht oder Coronalltag. Gedanke zu miesem Regenwetter: Eisheilige. Gräte Thunfisch. Nervt.
25.04.20, Zimmer
Habe vor wenigen Tagen angefangen, tiefschürfende, mitunter lebensrettende Gedanken auf Commerzbank Post-Its zu schreiben und rund um meinen Schreibtisch aufzuhängen. Wenn jemand fragt: Das ist nicht mein Humor.
19.04.20, Zimmer
Seit 30 Tagen gelten nun die Ausgangsbeschränkungen. So langsam fühle ich mich etwas einsam, ausgehungert an sozialen Kontakten. Nur ab und zu telefoniere ich mal aus der Quarantäne heraus. Abends quäle ich mich durch Netflix-Serien, von denen ich der Meinung bin, dass sie mir eigentlich gefallen müssten. Gefallen mir auch meist, allerdings nur für eine Viertelstunde. Puh. Und in einen Leseflow gerate ich auch immer seltener.
Während ich also konsequenterweise nach Frei Zeitalternativen suche, erwische ich mich in flagranti bei dem Gedanken, dass bestimmt bald alles wieder normal sein wird. 1. Bald? 2. Normal? Ich hole mich dann eigenständig von dieser irrational-träumerischen Leiter runter; auf den Boden der Zukunftsaussichtslosigkeit.
Zu 1.: Niemand kann wissen, maximal unwissenschaftlich und ungeduldig irrlichtern, wann ansatzweise so etwas wie Alltag wieder möglich ist. Und auch dann bleibt die Frage: Wie lange? Auf dem Boden der Tatsachen ist das nur allzu einsichtig für mich und trotzdem checkt das die Birne manchmal nicht und will raus: Leute sehen, Leben leben. Immerhin bestünde mein Alltag quasi nur aus Großveranstaltungen und damit aus wandelnden Masseninfektionsherden. Öffentlich in einer Millionenstadt U-Bahn fahren, mit tausend anderen in die Uni gehen und abends, na gut, abends ist eher dürftig.
Zu 2.: Man hört immer häufiger, dass zumindest Klima und Erde von der Pandemie profitieren. Puh. Ziemlich zynisch. Aber klar, die Normalität von Vorcorona, die voraussichtlich ja auch die von Nachcorona sein wird, ist gar nicht so normal, also im Sinne von tragbar für die Meisten. Man hört auch noch, dass jetzt die Chance bestünde, daran etwas zu ändern. So ne Art Lifestyle mit mehr Solidarität, Gleichberechtigung, Liebe, weniger Ausbeutung, Leid und Hass.
So ne Art neo-normales Korrektiv für die Auswüchse der Normalität.
09.04.20, Garten
Romanrezension zu «Faserland». Zeit is ja.
Umfang: 165 Seiten, bei normalem Tempo in drei Stunden gut machbar. Habe gehört, dass Christian Kracht mit jenem Buch, seinem Debüt, ebenso abrupt die Popliteratur killte, wie sie Nick Hornby kurz vorher über Nacht eingeführt hatte. Viel interessanter jedoch: Kracht verglich dessen Physiognomie mit einem Penis, 2001, bei Harald Schmidt sitzend.
Ach so, inhaltlich: Bin ziemlicher Fan, wenn es um die Beschreibung wohlstandsverursachter Sinnlosigkeit geht. Sprache daher top, wie bei Bret Easton Ellis, vielleicht sogar noch ein bisschen repetitiver. Kann mir aber dieses ekelhaft reiche, gelangweilte und zugedrogte Dandy-Deutschland Mitte der 90er einfach nicht vorstellen. Was ein Lifestyle. Da ist B.E. Ellis natürlich glaubwürdiger oder zumindest plausibler in seinen Beobachtungen, einfach wegen Los Angeles.
02.04.20, Wohnzimmer
Riesenaufschrei hier als durchgedrungen ist, wie die Niederlande und Großbritannien mit der Coronakrise umgehen wollen. Begriffe wie Herdenimmunität und bewusste Massenansteckung. Ihh, wie kontraintuitiv und gar nicht christlich: Spinnen die da drüben, respektive oben? Das ist vielfacher Mord, glasklar, soweit der kollektive O-Ton.
Ach ja, eine kurze Beobachtung: Ungefähr zeitgleich geben auch die USA ihren Coronakurs bekannt: Den Ernst der Lage kleinreden und bloß nichts einschränken. Obwohl der Umgang oder besser Nicht-Umgang mit Corona der US-amerikanischen Regierung dem Großbritanniens verblüffend ähnelt, führt ersterer zu weit weniger Empörung und Unverständnis in der deutschen Volksseele. Vermutlich, weil Donald J. Trump gemeinhin nicht die intellektuelle Größe zugeschrieben wird, Ausmaße und Konsequenzen der Pandemie jetzt schon überrissen zu haben. Oder, weil skrupellos in Kauf genommene Menschenopfer zu Gunsten einer ewig florierenden US-Wirtschaft wenig verwunderlicher Bestandteil der allgemeinen Weltgeschichtsschreibung sind.
Zurück zum beschriebenen Stimmungsbild und der Frage: Woher mag diese ethische Intuitionsdifferenz zwischen Deutschen und Brit*innen rühren? Wohl kaum aus Mangel an gutem Journalismus, Wissen, Intelligenz oder Tee respektive Bier? Nö.
Ein Näherungsversuch: Ethische Beurteilungen haben natürlich einiges mit Intuition zu tun. Und Intuition wiederum mit unserer Sozialisierung, welche nur eingedenk bestimmter historisch prägender Denkschulen verstanden werden kann, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ist ja schließlich mein Tagebuch.
Unser ethisches Grundverständnis ist ein kantisch-christliches. Klar, Menschenwürde und Nächstenliebe. Klar ist auch, dass Menschenleben nicht gegeneinander aufgerechnet werden können. Daher auch die breitgesellschaftliche Befürwortung der Ausgangsbeschränkungen, frei nach dem Motto: Jeder Mensch, der stürbe, ist einer zu viel. Dieses alleroberste Prinzip legitimiert dann konsequenterweise auch die Außerkraftsetzung anderer, ebenfalls ziemlich wichtiger Prinzipien, wie beispielsweise: Grundrechte. Nochmal klar. In Großbritannien hingegen ist das anders, die ethische Grundintuition eine pragmatischere. Da heißt die historische Ethikkoryphäe eben nicht Kant, sondern Bentham. Oder Mill. Die Gründerväter des Utilitarismus, der bekanntesten Spielart konsequentialistischer Ethik. Und Konsequentialismus definiert sich eben nicht durch die Dogmatisierung eines bestimmten wichtigsten Prinzips, sondern rückt allein die Folgen einer Handlung ins Zentrum der Bewertung ethischer Fragen. So lässt sich der Gedanke der Herdenimmunität allein anhand der (größeren) Zahl der dadurch Überlebenden rechtfertigen. Oder anhand derer, denen es besser geht (finanziell, mental, usw. usf.), zweitrangig hierbei erstmal, wie man das zu definieren, geschweige denn zu messen gedenkt. Alte und Gebrechliche wegsperren und die Jungen und Fitten weitermachen und möglichst rapide und umfangreich infizieren lassen. Ginge zwar auf deren Kosten, aber am Ende wäre der Nutzen eben größer und das ist dann o.k. So die Grundidee. Die ethische Intuition der WHO hinsichtlich der Coronapandemie dürfte zumindest der deutschen eher ähneln als der britischen, gab es doch ausreichend Kritik und Aufforderungen, von dem angedachten Kurs abzuweichen und endlich den Alltag in Großbritannien zu beschränken. Inwiefern dies wirklich zum Zurückrudern der Brit*innen beigetragen hat, scheint mir unter Berücksichtigung von Boris Johnsons Intensivaufenthalt eine spannende, weil spekulative Frage.
PS: Eins ist sicher: Ich hab‘ keine Ahnung von schwedischen Ethikphilosoph*innen. Trotz Recherche.
20.03.20, Auto
Ab morgen Ausgangsbeschränkungen in Bayern. König Söder legt vor. Doppelpass über Nürnberg nach Berlin: Mit sich selbst.
Illustration: Hannes Pfeiffer
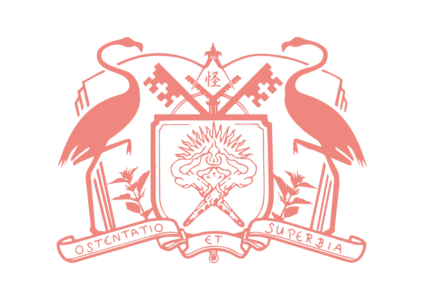
5.9. Balkonien Ich wohne in einem kleineren Ort in einem deutschen Mittelgebirge. Wenn ich aus der 40 km entfernt liegenden Großstadt zurückkomme, fahre ich gefühlt in die Ruhe und Entspanntheit eines mittellalterlichen Klosters.
Fünf Minuten Fußweg aus meiner Wohnung und ich bin in einem sehr großen Waldgebiet, indem ich stundenlang kaum einem Menschen begegne. Vor kurzem fand ich den Hinweis eines Managementcoach, der seinen gestreßten Klienten eine vierstündige Wanderung im Wald empfahl, um alle belastende Sorgen abzuwerfen. DAs kann ich nur bestätigen. Trotzdem fahre ich für den Jahresurlaub unglaublich gerne „raus aus Deutschland“, vornehmlich nach Katalonien, weil dort (noch!) für mein subjektives Empfinden, „alles“ anders ist: Häuser, Meer, Essen, Lebensstile, zumindest äußerlich. Und dass lenkt enorm ab, führt zu einer mentalen Entspannung erster Güte.