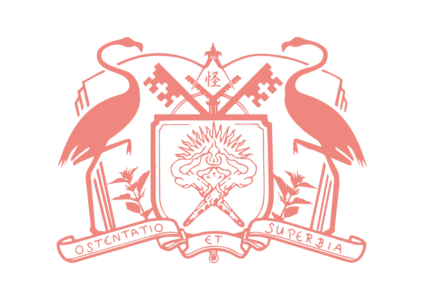Bild von Hannah Eirich.
Der Geruch von Schlaf hängt noch im Zimmer. Ich will Laurenz nicht wecken. Er schläft zusammengerollt, wie ein kastanienfarbenes Fellbündel, an der hinteren Ecke meines Bettes. Ich kann fühlen, dass Bettdecke, Laken und Kissen noch warm von mir sein müssen. Ich bin zurechtgemacht, habe noch Zeit, eine Tasse Kaffe zu trinken, sehe aber gleichzeitig, wie Koffer und Jacke in der Ecke stehen und auf mich warten. Draußen hängt der Nebel noch in den Baumkronen wie die Materie gewordene Unschärfe, die man verspürt, wenn man nach der Nacht das erste Mal die Augen öffnet. Es ist sehr früh. Im morgendlichen Halbdunkel kann man fast nur Silhouetten ausmachen. Die Straßenlaternen werfen noch ihr orangefarbenes Licht auf feuchten Asphalt, aber man ahnt schon, dass sie in weniger als einer halben Stunde obsolet sind und ausgeschaltet werden. Die morgendliche Dämmerung, von der man weiß, dass sie in diesem Moment die Wenigsten miterleben, fühlen sich seltsam intim an, als wäre die Geburt eines neuen Tages ein stilles aber magisches Ereignis.
Ich setze mich vorsichtig auf die Bettkante und hebe die Zeitung vom Boden auf. Aber als ich die Seiten auseinanderziehe und es leise raschelt, macht Laurenz die Augen auf. Die schwarzen Augen sehen trüb aus und schließen sich schnell wieder.
„Hm?“, sagt und gähnt Laurenz . Ich sage nichts, sondern hebe die Tasse an die Lippen und lasse den warmen Kaffee langsam in meinen Mund laufen. Müdigkeit ist ein seltsames Gefühl. Mein Körper sehnt sich nach einem Zustand zurück, den ich nicht kennen kann. Meine Gedanken gehen so träge wie eine hochschwangere Frau, und reihen sich dabei doch fast automatisch aneinander. Müdigkeit ist wie Hunger: eine Art der Vorfreude, die man nur dann genießen, wenn man den Hunger oder das Bedürfnis zu schlafen, zeitnah erfüllen kann.
Laurenz fragt sanft: „Was soll das?“
„Ich habe einen frühen Zug gebucht. Die sind manchmal billiger.“
Gerade als ich denke, dass Laurenz wieder eingeschlafen ist, durchbricht er die Stille: „Ich bin sehr froh, dass ich keinen frühen Zug gebucht habe.“
„Ja…aber einen frühen Zug nehmen bedeutet, dass ich früher wach bin, die Zugfahrt über nutzen kann und früher ankomme – mehr vom Tag haben.“
„Das klingt nach einem Gedankengang, den ich nicht nachvollziehen kann.“
„Musst du ja auch nicht.“
„Was sollen das bedeuten ,mehr vom Tag haben‘?“
„Mehr wache Stunden.“
„Aber wie entscheidest du, dass mehr wache Stunden gut sind? Kommt es nicht eher darauf an, dass du ,genug vom Tag‘ hast? Also soviel Zeit die du brauchst, um die Dinge zu tun, die du tun willst?“
Als Antwort wende ich Laurenz meinen Kopf zu und ziehe eine Augenbraue hoch. Er hält seine Augen immer noch geschlossen, hat aber den Kopf gehoben.
„Worauf bezieht sich dieses ,mehr‘? Bedeutet es, dass du mehr Zeit hast, um mehr zu erledigen? Oder geht es darum, dass du mehr Zeit zur Verfügung hast?“
„Wohl letzteres.“
„Aber das stimmt doch nicht, oder? Ist es nicht oft so, dass wenn man mehr Zeit hat, auch den Druck verspürt, diese Zeit zu nutzen?“
„Das kommt drauf an. Du tust ja gerade so, als würden wir jede Minute arbeiten und wenn wir mehr Zeit haben, dann arbeiten wir auch mehr.“
„Ist das nicht der Fall?“
Ich denke nach. „Okay“, sage ich resigniert aber einsichtig. „Dann will ich halt mehr vom Tag. Dann will ich meine Zeit halt nutzen. Dabei geht es ja nicht wie in einem kapitalistischem Albtraum darum, Leistung zu erbringen. Sondern viel fundamentaler: die Zeit, die ich habe, möchte ich nutzen. Denn sie ist ja begrenzt.“
„Aber wann ist denn deine Zeit genutzt? Dann, wenn du irgendetwas tust oder unterwegs bist? All die Jugendlichen, die mit siebzehn oder achtzehn die Schule abschließen und dann in die Universitäten geschwappt werden, anschließend vielleicht noch mal das Fach wechseln, einen Auslandsaufenthalt einbauen, zwischendrin die Liebe ihre Lebens finden, wegziehen, zurückziehen, innerhalb der Stadt umziehen, sich trennen, mit unter dreißig promovieren, arbeiten, arbeiten, arbeiten – eventuell in zwei Städten gleichzeitig und mehrere Jobs gleichzeitig. Die nutzen ihre Zeit bestimmt. Aber ist das sinnvoll?“
„Ich habe doch gesagt, dass es mir nicht um einen kapitalistischen Albtraum geht. Meine Zeit ist genutzt, wenn ich die Dinge tue, die ich tun will. Dabei will ich sie ja nicht in in Geld messbare Leistung verwandeln.“
„Ich glaube, dass es etwas komplizierter ist“, Laurenz hebt seinen Kopf und öffnet gleichzeitig die Augen. Sein Blick ist jetzt klar und ernst.
„Du kannst der Meinung sein, dass du deine Zeit nicht nach dem Diktum ,Zeit ist Geld‘ ausrichtest. Aber geht es nicht bei der Frage ,Wie nutze ich meine Zeit?‘ eigentlich um die Frage ,Was ist für mich sinnvoll?‘ Und mit ,sinnvoll‘ meine ich hier nichts weniger als den Sinn des Lebens. Damit meine ich, dass man halt wissen muss, was man vom Leben will und dementsprechend teilt man dann seine Zeit auf.“
„Oha“, sage ich. „Das hilft aber überhaupt nicht weiter. Ich kenne doch den Sinn eines Lebens nicht. Ganz im Gegenteil: ich fände es einen furchtbaren Gedanken, den Sinn des Lebens zu kennen. Was, wenn wir den Sinn unseres Lebens wüssten, ihn aber nicht mögen würden? Das Interessante am Leben ist doch die Sinnsuche.“ Ich nehme noch einen Schluck Kaffee.
„Das ist das, was ich sagen will: Man muss sich fragen, wie man sich seine Zeit einteilt. Genauso wie man sich fragen muss, wonach man im Leben sucht. Und darauf kann es keine Antwort geben, weil sonst wären wir ja nicht frei. Nur, wie vermeiden, dass man die Suche aufgibt und auf einer Autobahn der Zeit hinterherjagt, die man glaubt an Dinge zu verlieren, die einen davon abgehalten haben schneller zu fahren?“
„Naja“, sage ich, „Zeit verschwenden. Nur so beweist man sich selber seine Freiheit. Zwar kann man nicht jederzeitvon der Autobahn abfahren, aber man kann immer das Tempo bestimmen.“
Mit diesem Satz stehe ich auf, gehe zu meinem Schreibtisch und stelle die Tasse dort ab. Ich muss los. Mein Zug fährt bald ab. Als ich den Mantel über die Schultern werfe, sehe ich, dass Laurenz sich wieder zusammengerollt hat und die Augen geschlossen hält. Eigentlich hat er recht. Es kommt mir unnatürlich vor, mich in einen Zug zu setzten, erschöpft von einer kurzen Nacht, um irgendwohin zu fahren. Die Straßenlaternen sind ausgeschaltet worden. Der Nebel in den Baumkronen hat sich aufgelöst und den Blick auf die kahlen Äste freigegeben. Der Himmel ist eine graue, weit weit entfernte Decke. Die Genesis ist vorbei. Der Tag ist schon in der Pubertät.
Langsam schleiche ich aus meinem Zimmer, fahre in die Schuhe und ziehe die Haustür hinter mir zu.