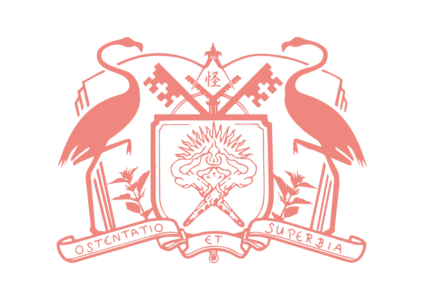Die kulturellen Produkte, die sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen, scheinen grob in zwei Kategorien zu fallen: Entweder die Zukunft ist schlecht – beispielsweise wurde die gesamte Erde durch einen erbitterten Atomkrieg zerstört und die überlebenden Menschen konnten sich gerade so auf ein defizitäres Raumschiff retten, treten einer transplanetarischen Vereinigung bei, sind aber den meisten Lebensarten unterlegen, woraus sich ein anständiger Minderwertigkeitskomplex entwickelt und sich die Menschheit selbst ausrottet oder auf einen einsamen Wüstenplaneten verbannt wird – oder die Zukunft ist einigermaßen cool: mit stylischen Multifunktionsganzkörperanzügen und Butlern, die strahlend blaue Flüssigkeiten servieren und eigentlich Aliens sind.
Der japanische Anime Ghost in the Shell I und Ghost in the Shell II – nicht das haarsträubend schlechte Remake mit Scarlett Johannson – zeichnet ein ziemlich kohärentes Bild davon, wie die Zukunft ist, wenn sie kein Paradies ist. In Tokio, am Ort des Geschehens, verdeckt gräulicher Dunst den Himmel, es gibt große Unterschiede zwischen Arm und Reich, Wohnraum scheint knapp, weswegen man in riesigen, weit in den Himmel ragenden Wohnkomplexen wohnt, alles wirkt abgenutzt, provisorisch, kränklich, verfallen. Manche Menschen im Ghost in the Shell-Universum sind Cyborgs, also Menschen, deren Körper größtenteils Maschinen sind. Sie sind die Geister in den Schalen. Wiederum manche wurden nicht einmal geboren, sondern sind im wahrsten Sinne des Wortes zusammengebaut worden. Es sind Grenzidentitäten, die darunter leiden, dass sie keine Narrative in ihrem Leben finden können, sondern im einen Moment nicht da und dann auf einmal da waren. Die Technik ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass Erinnerungen gelöscht, verfälscht oder zerstört werden können. Außerdem lassen sich Wahrnehmungen verzerren und das Bewusstsein manipulieren. Realität ist ein zersplitterter Begriff, der keine Orientierung mehr bietet. In diesem Setting werden Fragen, die ohnehin schon schwer zu beantworten sind, noch prekärer. Was macht den Menschen zum Menschen, wenn er selbst nur noch zu einem sehr kleinen Teil menschlich ist? Was bedeutet noch freier Wille und Moral, wenn Wahrnehmung und Erinnerung nach Belieben modifiziert werden können? Ghost in the Shell kulminiert Fragen nach dem Menschen und Menschsein im Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine und zwingt sie in scheinbar unüberwindbare Paradoxien.
Das Space-Epos Star Wars trägt schon im Namen, was es an der Zukunft interessant findet: Krieg. Interessanter Weise spielt Star Wars gar nicht in der Zukunft, sondern in einer Galaxy far far away und a long time ago. Dennoch ist das, was in Star Wars vorkommt – vor allem Raumschiffe, Aliens, Laser – ziemlich deckungsgleich mit dem, was unsere Vorstellungen von der Zukunft sind. Star Wars ist also nicht wirklich a long time ago, sondern für uns eher in a galaxy far far away. Die Handlung von Star Wars in allen Einzelheiten zu erklären, käme ungefähr dem Versuch gleich, eine Herde Schafe unbemerkt in eine Bibliothek zu schmuggeln. Festhalten lässt sich aber, dass es vor allem um den Kampf zwischen Gut und Böse geht. Daher der Name „Sternenkrieg“ oder „Krieg der Sterne“. Die guten Jedi, eine geistliche Elite, die über göttliche Kräfte verfügen, kämpfen gegen die bösen Sith, die genauso sind wie die Jedi, im Gegensatz zu den Jedi aber mehr schwarz tragen und sich nicht an Abkommen halten. Um diesen sehr grundlegenden Konflikt herum gibt es noch einen ganzen Haufen galaktischer Politik, zutiefst menschlicher Gefühle und da steckt bestimmt auch irgendwo ein Ödipus-Komplex drin. Aber auch in Star Wars ist Produktionskapital ungerecht verteilt, Menschen werden versklavt, die politische Macht liegt in den ganz falschen Händen, es herrscht Krieg. Das kommt einem doch bekannt vor. Die Welt, die Star Wars zeichnet, ist eigentlich genauso wie unsere – politische Missstände inklusive, wenn man den Vergleich zwischen Kanzler Palpatine und Putin unbedingt ziehen möchte.
Star Wars und Ghost in the Shell sind insofern paradigmatisch für die Verarbeitung von Zukunft in einem kreativen Sinne, als dass beide nicht um bestimmte Grundkonstanten herumzukommen scheinen. Das soll nicht bedeuten, dass das Frauenbild in vielen Zukunftsuniversen besonders offensichtlich der feuchten Phantasie eines verzerrten Schönheitsideals entspringt. Gemeint sind vielmehr Grundkonstanten wie zum Beispiel Fragen, die sich immer und immer wieder stellen; danach zum Beispiel, ob am Ende die Guten oder die Bösen gewinnen. Oder, ab welchem Grad an Veränderung – durch Verlust des Gedächtnisses oder Cyborg-Transformation – wir denn noch wir sind oder was wir dann überhaupt sind.
Diese Grundkonstanten kommunizieren eine ambivalente Botschaft. Auch wenn das jetzt die Zukunft ist, sind wir nicht unbedingt weitergekommen. Warum deutet das Wort Zukunft mit beinahe 100-prozentiger Treffsicherheit auf eine Verschärfung – Ghost in the Shell – oder zumindest einer Fortführung – Star Wars – gewisser Problematiken, die wir eigentlich aufgelöst sehen wollen? Warum begreifen wir die Zukunft weniger als Möglichkeit, sondern eher als Problematik? (Und mit „wir“ sind hier die Künstler und das Publikum, die die bisherige Analyse teilen, gemeint – und keine Technikoptimisten aus dem Silicon Valley.) Es scheint so zu sein, dass wir der Zukunft eine ganz eindeutige Zeichen-Funktion zuschreiben, in deren Eindeutigkeit wir gefangen sind.
Das Phänomen, dass einem Wort scheinbar immer eine rigorose Bedeutung zukommt, beschäftigte schon Jaques Derrida. Aber in der Grammatologie kommt er zu dem Schluss, dass ein Zeichen nicht notwendigerweise das bezeichnen muss, was es zu bezeichnen scheint. Eine solche strenge Zeichentheorie müsste nämlich eine relativ fragwürdige Ontologie annehmen. Derrida nennt sie „Logozentrismus“. Das meint, grob gesagt, die Vorstellung, Zeichen seien das, was wir artikulieren, wenn wir uns auf sie beziehen. Das, worauf wir uns dabei beziehen, muss dann aber tatsächlich einmal „präsent“ und rational begreifbar gewesen sein. Die Konsequenz wäre, dass „außerhalb des Logos nichts ist“ (Grammatologie; 38.) – zumindest nichts, was sich aussprechen ließe. Sprechen, in dieser Argumentationslinie, wäre dann insofern der Schrift überlegen, weil es „unmittelbarer“ auf das Bezeichnete bezogen wäre. (Vgl. Grammatologie; 27f.) Derridas berühmte Schlussfolgerung aber ist, dass es eben nicht so ist. Der Sinn eines Wortes ist nicht fixiert: Es muss „das Bezeichnete“ in keinem strengen Sinne geben. Damit ist nicht gemeint, dass ein Auto auf einmal Hund heißen kann. Der Sinn eines Wortes, also das, was ein Wort für uns bedeutet, ist vielmehr das, was sich verändern kann (vgl. „Philosophie Magazin“). Derrida verweist darauf, dass geschriebene Worte eine différance – eine Lücke zwischen dem, was es bezeichnet, und dem, welchen Sinn es hat – aufweisen können:
„Wenn wir einen Text lesen, machen wir die Erfahrung, dass Zeichen und Bezeichnetes nicht unauflöslich aneinanderkleben, sondern die Bedeutungen ‚gleiten‘, sie verändern, verschieben sich: Sie sind offen.“ (Philosophie Magazin)
Derridas Methode, Zeichen und Bezeichnetes voneinander loszubinden, ist die Dekonstruktion. Zeichen verlieren ihre rigorose Bedeutung, wenn man sie anders verwendet, in andere Kontexte stellt, den Zusammenhang, in dem sie erscheinen, stört. Nur in dieser Lücke, die gerissen wird, entsteht etwas Neues. Was also machen, wenn der Begriff Zukunft relativ treffsicher auf relativ einfach auszumachende Probleme zu zielen scheint?
Versuchen, ihn umzudeuten. Literatur, Kunst und Filme produzieren, die den Rahmen des Möglichen erweitern. In Zukunft muss man vielleicht keine seltsamen Frisuren tragen und Sex mit Sexrobotern haben. In Zukunft sind unsere Roboter vielleicht eher wie Marcel Reich-Ranicki und weniger wie Siri. Die nächste transplanetarische Organisation ist vielleicht radikal anarchistisch, weil Macht- und Gewaltausübungen einfach obsolet geworden sind. Statt Google-Glasses und VR-Brillen kann man sich Flügel aus fluoreszierenden Federn anoperieren lassen und hört Dub-Barock. Wer weiß.
Bild gefunden auf DeviantArt.