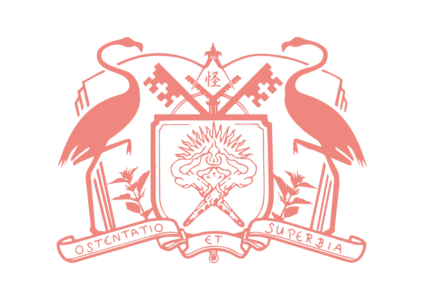Ein Gespräch mit Simon Geschke über das Heroische, Teamgeist und die öffentliche Wahrnehmung von Doping im modernen Profisport.
Sport scheint wie auch Kunst ein kulturelles Grundbedürfnis des Menschen zu sein. Seit dem Altertum finden sich in Kulturkreisen rund um die Welt und in jeder historischen Epoche zahlreiche Formen des physischen Wettstreits. Die Geisteswissenschaften haben dem Sport dagegen lange kaum Bedeutung beigemessen, galt in der abendländischen Philosophie doch eine paradigmatische Trennung von Körper und Geist. [1] Haben Sport und Philosophie sich also nichts zu sagen? FUNZEL-Autor Johannes K. Staudt hat eine Annäherung gewagt: Ein Gespräch mit dem in Freiburg lebenden Radprofi Simon Geschke über das Heroische, das Verhältnis von Mannschaft und Individuum und Doping im kommerzialisierten Profisport.
Simon Geschke, geboren 1986 in Berlin, ist seit 2008 Berufsradsportler, gewann 2015 eine Etappe der Tour de France, 2019 die Bergwertung der Tour de Pologne. Er fuhr auf den Dritten Platz der Tour Down Under 2020 und hatte als Helfer bedeutenden Anteil am Tom Dumoulins Sieg beim Giro d’Italia 2017. Er ist Mitglied in der Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport MPCC und steht seit 2021 bei der französischen Mannschaft Cofidis unter Vertrag.
JKS: Simon, du warst zuletzt bei den Olympischen Spielen in Tokio in der breiten Öffentlichkeit, weil du als einziger deutscher Athlet in den zweifelhaften Genuss einer Quarantäne in Regie des IOC gekommen bist. Wir möchten dich aber gerne für deine eigentliche Profession kennenlernen: Wie kamst du zum Radsport? Was fasziniert dich am meisten?
SG: Ich bin über meinen Vater zum Radsport gekommen. Er war früher Bahnradsportler. Nach seiner Karriere ist er dann sehr viel Mountainbike gefahren und hat mich, als ich klein war, mitgenommen. Ich bin dann die ersten zwei, drei Jahre mit Mountainbike-Rennen groß geworden. Mit 15 bin ich in den alten Verein von meinem Vater in Berlin und wollte dann auf jeden Fall Straßenradsportler werden, weil das die Zeit war, wo Jan Ullrich die Tour gewonnen hat – 1997 gerade 11. Das war die erste Tour de France, die ich so richtig verfolgt habe. Es war schon ein bisschen mein Traum – ich wollte dann unbedingt auch Straßenradsport probieren.
Das hat man sich am Anfang alles schön vorgestellt. Zwischenzeitlich war das dann auch sehr hart, neben der Schule immer noch die Trainingsumfänge alle so hinzukriegen. So im Nachhinein hat mein Abitur auch ganz schön darunter gelitten – aber für die Profikarriere war’s definitiv eine gute Entscheidung. Es ist natürlich keine Garantie, dass man Profi wird – es schaffen dann doch sehr wenige nur. Daher war’s auch für mich lange nicht sicher. Ich war jetzt kein Mega-Ausnahmetalent in den Nachwuchsklassen, aber es hat dann zum Glück geklappt und jetzt bin ich seit [2009] dabei.
JKS: Dass jemand sich durch seine ganze Jugend zu solchen Leistungen motivieren kann, ist sehr beeindruckend. Wir haben einige Rennradfahrer in der FUNZEL-Redaktion und wissen daher, dass der Radsport selbst für Freizeitsportler eine zeitintensive Leidenschaft ist. Profi zu werden verlangt noch einmal eine völlig andere Qualität der Selbstaufopferung.[2] Hast du jemals darüber nachgedacht, aufzuhören? Und was hat dich dazu bewogen, weiterzumachen?
SG: [Schmunzelt]. Ja, sehr oft sogar – auch noch als Profi. Aber es sind halt zum Glück immer nur kurze Momente und die beste Lösung ist dann immer, erstmal ‘ne Nacht drüber zu schlafen. So schnell kommt man aus der Nummer halt meistens eh nicht raus. Oft hilft es dann auch, erst einmal eine Woche ruhig angehen zu lassen.
Gerade während meiner Jugend hatte ich schon auch andere Sachen im Kopf, aber – wie du schon sagst – es ist eine sehr zeitaufwendige Sportart. Man hat eigentlich für fast nichts anderes Zeit und meine Jugend war auch nicht so wie bei vielen anderen, dass ich jetzt viel auf Partys war oder viel mit Freunden gemacht habe. Anfangs schon noch; aber dann habe ich halt gemerkt, dass irgendwie immer etwas auf der Strecke bleibt – entweder meine schulischen Leistungen oder das Radfahren. Und am Ende haben dann doch meine Freundschaften gelitten, weil ich einfach keine richtige Freizeit mehr hatte. Und da hatte ich schon ein paar harte Momente, wo ich dachte: „Warum machst du das eigentlich alles?“ Ich bin dann trotzdem dabeigeblieben, weil man dann halt doch irgendwie weitermacht. Dann macht’s halt mal ‘ne Woche keinen Spaß, aber dann geht’s auch wieder. Dann fährt man irgendwann wieder ein gutes Rennen und weiß dann auch wieder, wofür man es macht.
Nachdem ich mein Abitur hatte, wurde dann vieles leichter, weil ich einfach viel mehr Zeit fürs Radfahren hatte – und dann auch alles auf eine Karte gesetzt habe. Wenn ich nach der U23 nicht Profi geworden wäre, hätte ich studiert oder eine Ausbildung gemacht. Ich denke, das hat auch den Ausschlag gegeben, dass ich zum Glück Profi werden konnte.
JKS: Meine Faszination für den Radsport wurde geweckt, weil die Übertragungen der Tour de France, eine ungewöhnliche Mischung aus Sport und Kultur geboten haben. Im Gegensatz zu anderen Sportarten findet der Straßenradsport nicht in einem Stadion, sondern mitten in der Alltagswelt statt. Das verleiht ihm einen einzigartigen historischen Charakter. So hat der Volksmund zum Beispiel das Eintagesrennen Paris – Roubaix „Die Hölle des Nordens“ getauft; ein Kosename, in dem sich der Eindruck der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs mit der sportlichen Herausforderung eines Radrennens über Landstraßen aus 200 Jahre altem Kopfsteinpflaster vereint. Ähnlich ist der Stereotyp des „Flandrien“, in dem die belgische Region zum Synonym für Fahrer wurde, die auch bei schlechten Straßen, Gegenwind, Kälte und Regen unbeeindruckt ihre Leistung auf die Straße bringen.[3] Heute steht diese Aura des Heroischen jedoch im scheinbaren Gegensatz zu einem professionalisierten Sport, in dem kommerzielle Mannschaften versuchen, mit wissenschaftlichen Mitteln jedes Prozent zu optimieren. Welche Rolle spielt diese kulturelle Dimension im modernen Profisport?
SG: Es ist ebendiese Vielschichtigkeit, die mich am Radsport so fasziniert, dass man nicht im Stadion im Kreis fährt, sondern zu den Zuschauern kommt und durch die Orte fährt und durch die Länder. Ich war inzwischen schon in so vielen Ländern und bin da Radrennen gefahren. [Diese] vielen Facetten sind schön und auch faszinierend: Jedes Rennen hat seine eigene Charakteristik; allein bei der Tour hat man 21 komplett verschiedene Etappen – von der Länge her, vom Profil und von den Anforderungen. Dann gibt’s das Rennen im Rennen – das Rennen um den Etappensieg und das Rennen um den Gesamtsieg. Es ist super vielschichtig und es ist halt auch für jeden Fahrertypen irgendwo etwas dabei. Man fährt mit Leuten, die wiegen 90 Kilo, und mit Leuten, die wiegen nur 58 Kilo. Daher hat [jedes] Rennen und [auch] der komplette Sport eine ganz eigene Dynamik und das finde ich ziemlich cool.
Diese Romantik ist noch etwas aus der vergangenen Zeit [und] die ist natürlich nach wie vor da, aber der Radpsort hat sich schon zu einem komplett wissenschaftlichen Sport entwickelt. Das kann man nicht mehr ignorieren, weil wirklich jedes Team alles tut, um noch irgendwo ein halbes Prozent rauszuholen. Klamotten, Helme, das [ganze] Material spielt eine große Rolle. Auch der Fahrer probiert immer an sich zu schrauben. Da werden dann [beispielsweise] ganz komische Diäten gemacht: am Tag vorm Rennen keine Ballaststoffe essen, damit man kein Wasser einlagert, um nochmal ‘n halbes Kilo weniger zu haben – aber nur vor den Bergetappen, weil auf drei Wochen braucht man natürlich auch Ballaststoffe. Also da wird an Schrauben gedreht, [über die] ich mir vor zehn Jahren auch noch keine Gedanken gemacht habe oder für möglich gehalten habe, dass es einmal soweit kommt. Dann die Rennvorbereitung: Wir haben im [Team]bus einen Bildschirm mit einer Software, die uns jede Kurve in jeder Straße an[zeigt]. Da können wir uns das Finale angucken oder die letzten fünf Kilometer vor einem entscheidenden Berg, um zum Beispiel zu sehen: Wie breit ist da die Straße? Stehen da Bäume oder nicht? Wo kommt der Wind her? Jeder ist auf jedes Detail vorbereitet.
Das ist natürlich schon ganz anders als in der guten alten Zeit, wo die Fahrer, wenn man ganz früher guckt, mit ‘ner Flasche Wein im Trikot die Tour de France gefahren sind.[4] Der Sport hat sich komplett krass entwickelt und trotzdem ist diese Romantik natürlich immer noch ein Teil davon – gar keine Frage. Wir fahren immer noch die bekannten Rennen, wenn man die Tour de France sieht oder auch Paris – Roubaix oder Mailand – Sanremo. Die Rennen sind alle schon so alt und [führen] immer noch über dieselben Strecken, was immer sehr schön ist. Und der Radsport kommt zu den Leuten und nicht die Leute zum Radsport. Die kommen zwar auch an die Strecke, aber wenn man zum Beispiel ein Haus am Poggio hat, dann kann man sich jedes Jahr Mailand – Sanremo angucken. Das ist schon ziemlich cool und das macht den Sport auch gewissermaßen einzigartig.
JKS: Die Tour de France war ein gutes Stichwort, denn da sind wir uns dieses Jahr schon einmal begegnet: Auf der 8. Etappe von Oyonnax nach Le Grand-Bornand. Gemeinsam mit zwei Freunden war ich am Col de la Colombière geradelt, um deine Kollegen und dich in Aktion zu erleben. Während wir drei Stunden an der Strecke warteten, habe ich euch nicht sehr beneidet: Ihr habt bei kaltem Wind und strömendem Regen 151 Kilometer und fünf Berge mit insgesamt 3.558 Höhenmetern überwunden. Die Fahrer in aussichtsreichen Positionen hatten selbst am Colombière noch ordentlich Punch, einigen anderen sah man eine eher stoische Haltung oder auch echtes Leiden an. Nimm uns doch einmal mit auf diesen finalen Anstieg: Empfindet man als Profi, wenn man nicht gerade um den Etappensieg kämpft, dabei noch etwas Heroisches darin, Bergen, Wind und Wetter getrotzt zu haben?
SG: Das Wetter spielt eine essentielle Rolle im Radsport. Wir müssen leider bei fast jeden Wetter raus. Es gibt zwar inzwischen schon auch Protokolle von der UCI [Union Cycliste Internationale], dass bei extremem Wetter [Rennen] verkürzt werden können oder müssen – gerade bei Schnee, schlechter Sicht, Sturm oder auch extremer Hitze – dass wir jetzt auch nicht alles mit uns machen lassen müssen. An dem Tag war es kein extremes Wetter, aber trotzdem sehr unangenehm. Gerade, wenn man drei Wochen lang fährt und dann so ein Tag dazwischen hat, zieht der einem doch mehr Körner, als einem lieb ist. Und wenn man keinen Auftrag hat oder nicht um den Etappensieg mitfährt, geht’s dann halt wirklich nur ums Ins-Ziel-Kommen. [Meistens] hat man noch andere Aufgaben. Wir hatten zum Beispiel jemanden dabei, der in der Gesamtwertung ganz gut lag; er ist am Ende 8. geworden. Da unterstützt man natürlich seinen Kapitän, solange es geht. Man hat also auch, wenn man nicht auf Etappensieg fährt, immer eine Aufgabe im Team – und wenn es nur ist, Flaschen zu holen. Manche Leute werden auch wirklich dafür abgestellt, [am Berg] mit dem Sprinter mitzufahren, damit der nicht aus dem Zeitlimit fällt. Gar keine Aufgabe hat man also selten. Aber das kommt auch mal vor und dann ist man einfach froh, wenn das Ziel erreicht ist. Da ist man jetzt auch nicht mega stolz, es geschafft zu haben, weil Schaffen tut man’s immer irgendwie. Man trainiert ja auch bei Regen und muss oft genug im Winter mal bei Ekelwetter raus – häufiger als man will, logischerweise. Und ich bin überhaupt kein Fan von kalten Temperaturen. Ich habe auch noch nie ein gutes Rennen bei kalten Temperaturen gehabt. Daher bin ich immer froh, wenn schönes Wetter ist.
JKS: Es ist unübersehbar, dass Sport, auch wenn er zum Beruf wird, ohne persönliche Leidenschaft nicht vorstellbar ist. Zu sehr muss man dem sein ganzes Privatleben bis in kleine Details unterwerfen. Auch bei den Olympischen Spielen war dieser Tage wieder vielfach zu sehen, wie der Gewinn oder das knappe Verpassen einer olympischen Medaille die Athleten emotional an ihre Grenzen brachte. Dabei ist jeder dieser Profis, bis er das Weltniveau erreicht, durch viele Jahre den Erfolg und das Siegen gewohnt. Der Radsport ist dabei noch einmal speziell: Während Sieg oder Niederlage vom gut funktionierenden Teamwork der ganzen Mannschaft abhängen, erscheint am Ende nur der siegreiche Fahrer im Palmarès. Wie gehst du mit dieser Spannung um, dass man solch extreme Leistungen und Opfer bringt, sich dies aber meist nicht im eigenen Palmarès niederschlägt?
SG: Es gibt viele Profis, die nicht viel gewinnen oder die nie ein Rennen gewinnen als Profi. Es ist dann halt doch ein Beruf und der Radsport ist da halt auch sehr einzigartig, weil er eine Teamsportart ist, obwohl nur einer gewinnt am Ende. Und es wird immer für den Besten gefahren. Du bist halt auch limitiert. Also ich habe zum Beispiel auch nicht viele Rennen gewonnen in meiner Profikarriere. Man kennt seine Grenzen irgendwann extrem gut und weiß, wer gewinnen kann und wer nicht. Gerade auf dem Level wie bei der Tour de France oder allgemein in der WorldTour[5], gibt es echt nicht viele Fahrer, die große Rennen gewinnen können. Das akzeptiert man dann einfach irgendwann; der Rest sind dann halt Helfer oder zum Teil auch gute Fahrer, [die] kleinere Rennen gewinnen können oder auch mal hier und da ein WorldTour-Rennen, aber es ist definitiv nicht einfach. Gerade beim bekanntesten Rennen – der Tour – ist das Level halt so hoch, dass ich für meine Verhältnisse schon immer mit einem Top-Ten-Platz auf einer Etappe zufrieden bin, weil selten Underdogs gewinnen – weder Etappen- noch Gesamtsieg. Das gibt’s da einfach nicht; dafür ist das Level einfach zu hoch. Und jeder weiß, wie der Hase läuft, also wie die Etappen gefahren werden. Da verpokert sich auch keiner, dass dann irgendwie jemand fahren und auf zehn Minuten weggelassen wird. Es ist dann taktisch schon so durchgeplant, dass da meistens auch das passiert, was geplant ist.
JKS: Im Zweifelsfall konzentriert man sich also auf die eigene Aufgabe und motiviert sich damit, mannschaftsdienlich zu fahren?
SG: Genau, ich hatte jetzt dieses Jahr zum Beispiel kein Ergebnis bei der Tour, aber ich bin deswegen trotzdem keine schlechte Tour gefahren und war gut drauf. Man merkt auch, ob man gute Beine hat oder nicht. Es hat für mich persönlich einfach nicht so richtig funktioniert, aber ich war im Finale immer lange mit bei Guillaume Martin, der dann am Ende 8. wurde. Ihn lange zu unterstützen war eigentlich meine Hauptpriorität, weswegen ich mit zur Tour genommen wurde. Das habe ich gut gemacht. Leider ist kein Ergebnis rausgesprungen – dass man mal einen Tag in die Ausreißergruppe gehen kann und dann vielleicht auch unter die ersten zehn oder sogar die ersten fünf fährt oder im besten Fall halt auch mal ‘ne Etappe gewinnt. Aber bei der Tour ist das so schwer, wie bei keinem anderen Radrennen. Da muss man dann auch einfach akzeptieren, wenn’s mal nicht so läuft.
JKS: Mit dem der 8. Platz von Guillaume Martin lag euer Ergebnis ja sogar etwas über den Erwartungen der Fachpresse.[6] Nach der 14. Etappe lag er zwischenzeitlich sogar auf Platz 2.
SG: Ja, genau. Da haben wir auch schon ein bisschen von den Top-5 geträumt, aber dann leider doch wieder ein bisschen büßen müssen für seine Investitionen am Vortag. Am Tag danach hat er wieder ein bisschen Zeit verloren. Aber mit dem 8. Platz waren wir super zufrieden. Wie gesagt, man kann auch eine gute Tour fahren, man kann eine gute Karriere haben, ohne die eigenen Ergebnisse in den Vordergrund zu stellen. Wenn ich zum Beispiel an Lead-outs [für die Sprinter] denke: Da gibt es Fahrer, die fahren 1A-Lead-outs und gewinnen selbst nie große Rennen, sind aber super wichtige Fahrer im Team. Es gibt viele Aufgaben im Team und da gibt’s viele Fahrer, die wenig Ergebnisse haben, aber super wichtig sind.
JKS: Für dich scheint es in dieser Hinsicht beim Team Cofidis gut zu passen. Zugleich gehörst du eher zu den Veteranen im Profiradsport. Wie sehen denn deine weiteren Ziele aus? Was würdest du dir für deine Karriere noch wünschen?
SG: Ich bin jetzt 35, deswegen werde ich keine Leistungssprünge mehr machen. Ich probiere, die nächsten Jahre noch stabil zu bleiben. Ich habe nochmal zwei Jahre bei Cofidis unterschrieben, weil ich mich hier ganz gut eingelebt habe; und mit den Fahrern machts Spaß. Ich muss noch so ein bisschen die Sprachbarriere überwinden. Mein Französisch ist noch nicht gut genug, um wirklich fließend mit allen zu sprechen. Das habe ich mir groß vorgenommen als die letzte Challenge meiner Karriere und denke, dass die nächsten zwei Jahre meine letzten als Profi werden. Dann bin ich 37 und dann ist es, denke ich, Zeit, Lebewohl zu sagen.
Meine persönlichen Ziele würde ich jetzt nicht klar definieren. Jedes Jahr kann halt auch gut oder schlecht laufen. Kleine Details machen manchmal schon Riesenunterschiede. Dieses Jahr hatte ich im Frühjahr einen angebrochenen Rückenwirbel, der mich lange Zeit und Nerven gekostet hat. Und die Quarantäne jetzt nach der Tour war auch nicht optimal. Daher war die Saison bis jetzt ein bisschen durchwachsen. Ich hoffe einfach, dass ich in den nächsten zwei Jahren ohne Verletzung durchkomme, stabile Leistung bringe und vielleicht auch nochmal mehr persönliche Erfolge habe als dieses Jahr – obwohl die Saison auch noch nicht zu Ende ist. Vor allem im Vergleich zum letzten Jahr: Da hatte ich mehr persönliche Ergebnisse, was schöner war, aber da war ich auch noch in einem anderen Team. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, die nächsten zwei Jahre ein reiner Helfer zu sein; an meiner Karriere wird sich dadurch nicht mehr viel ändern.
JKS: Sprachbarrieren sind offensichtlich ein gemeinsames Problem von internationalem Sport und internationaler Wissenschaft. Im Peloton, das aus vielen verschiedenen Mannschaften besteht, muss man immer wieder unterschiedliche Interessen aushandeln. Hilft es da, mehrsprachig zu sein oder läuft das so routiniert, dass Mehrsprachigkeit eigentlich überflüssig ist?
SG: Ich würde sagen, Hauptsprache im Feld ist schon inzwischen Englisch. Obwohl es auch viele Spanier, Italiener und Franzosen gibt, die kaum Englisch sprechen. Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber man verständigt sich schon immer irgendwie. Ich will [vor allem] wegen des Teams gut Französisch lernen – und für den Rest des Lebens schadet’s sicher nicht. Das ist also eine Chance, die ich jetzt in dem Team habe und die ich auch nutzen will. In den heißen Rennphasen, finden nicht noch mega viele Konversationen statt; aber Mehrsprachigkeit ist im Radsport auf jeden Fall ein Vorteil. Da gibt es Fahrer, die sprechen fließend Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch – die sind natürlich schon zu beneiden.
JKS: Leidenschaft, Teamgeist und Professionalität führen leider auch immer wieder zu Betrug. Gerade in der deutschen Öffentlichkeit wird der Radsport bis heute stark assoziiert mit den Dopingskandalen zwischen 1990 und 2007 (an denen auch die Sportmediziner der Uni Freiburg beteiligt waren[7]). Zugleich hat sich seither viel getan: Die UCI hat eines der strengsten Anti-Doping-Reglements und mit dem Mouvement pour un Cyclisme Credible (MPCC) gehen dein Team und einige andere noch einen deutlichen Schritt weiter.[8] Die Diskussionen um die fabelhaften Tour-Siege von Tadej Pogacar zeigen aber, dass der Radsport noch immer unter einer besonderen Beobachtung steht – scheinbar ohne Möglichkeit, proaktiv die eigene Unschuld zu beweisen. Wie geht man mit dem öffentlichen Misstrauen um? Und fährt bei dir im Rennen der Zweifel mit?
SG: Das öffentliche Misstrauen ist ein großes Problem, das ich sehr schade finde. Leider orientiert man sich immer noch an vor zwanzig Jahren, statt darüber zu berichten, wie die Kontrollen sich eigentlich geändert haben und wie der Radsport da in vielen Sachen auch ein Vorreiter ist. Vergleicht man zum Beispiel mit der Nummer-1-Sportart in Deutschland, dem Fußball, dann ist es lächerlich, wie da kontrolliert wird, wo inzwischen Fußball auch ein heftiger Ausdauersport ist. Das ist sehr schade! Damit geht man natürlich als Radprofi auch ein bisschen frustriert um. Dieses öffentliche Misstrauen begleitet mich meine ganze Karriere schon. Leute, die sich mehr mit Radsport beschäftigen, wissen eher, [was sich getan hat]. Mit Leuten von außen, die immer nur hier und da was aufschnappen, diskutiere ich da extrem ungern drüber und es ist etwas sehr Frustrierendes.
Man beschäftigt sich auch deshalb immer noch viel mit den 1990ern und Anfang-2000ern, weil es nie wieder danach einen riesigen, flächendeckenden Skandal gab – wie zum Beispiel mit Fuentes[9]. Der soll ja auch Fußballspieler behandelt haben, wo komischerweise alle Beutel vernichtet wurden – warum auch immer… Also irgendwie hat der Radsport da auch nur mehr drunter gelitten als andere Sportarten, obwohl der Skandal, der manchmal als reiner Radsportskandal dargestellt wird, ein Sportskandal. Das wissen die meisten Leute auch nicht. Und diese Berichterstattung trifft einen als Radsportler schon manchmal sehr. Es gab auch im Fußball schon Wettskandale, über die dann nach einem Tag gar nicht mehr berichtet wurde. Also das ist schon sehr seltsam wie über manche Sportarten eine schützende Hand gehalten wird, während andere Sportarten mit dem Knüppel durchs Dorf getrieben werden. – Zurecht natürlich auch: Die Skandale waren alle nicht von ungefähr und das war natürlich eine schlimme Zeit im Radsport.
Ich bin froh, dass ich in der Zeit nicht Profi geworden bin. Ich habe jetzt die sauberen Jahre mitgekriegt und trotzdem fährt der Zweifel ohne Frage auch mit. Es ist auch schwer zu sagen; man will ja auch keinen beschuldigen. Selbst, wenn alle sauber wären, würde irgendein Fahrer der dominante Fahrer in der Tour sein, weil er einfach das Talent und das Timing im Training hatte – und das war nunmal dieses Jahr Tadej Pogacar. Jetzt kann man natürlich sagen: „Naja, der hat jetzt halt einfach nur am besten gedopt.“ Aber ich glaube, man sollte es sich nicht so leicht machen. Das ist auch unfair, dem Sportler gegenüber, weil es halt laut den Kontrollen nicht so ist. Und der Radsport wird am härtesten kontrolliert. Selbst ich als relativ Unbekannter werde ständig kontrolliert: Dann klingelt’s morgens an der Tür und die Dopingkontrolle steht da – ohne irgendeine Ankündigung. Ich glaube, die wenigsten Leute können sich vorstellen, wie viel wir Sportler da eigentlich machen müssen, um unsere Unschuld zu beweisen. Und den meisten Leuten reicht das aber immer noch nicht, weil es vor 20 Jahren Skandale gab und das ist sehr schade.
JKS: Die Frage nach dem Schuldbeweis hat jüngst noch einmal neue Brisanz bekommen: In Doping-Verfahren ist bisher der Sportler in der Pflicht, bei einer positiven Doping-Probe seine Unschuld zu beweisen. Eine Dokumentation der ARD-Sportschau hat nun gezeigt, dass eine positive Probe aber schon durch einfache Berührungen herbeigeführt werden kann.[10] Saubere Athleten, die Opfer eines derartigen Anschlags werden, haben derzeit kaum eine Chance, ihre Unschuld zu beweisen.
SG: Ja, genau. Es würde einem nie jemand glauben. Ich wusste das vorher auch nicht, dass das überhaupt möglich ist. Das ist natürlich krass! Es ist dann die Frage, wie glaubwürdig der Sport überhaupt ist und da rede ich jetzt nicht nur vom Radsport. [Denn] wenn man als Sportler positiv ist, ist man abgestempelt und das war’s – ob man jetzt daran schuld ist oder nicht. Die Ausreden waren natürlich zum Teil auch immer lächerlich und waren sicherlich das, was sie sind – Ausreden. Ich denke, größtenteils wurde absichtlich gedopt und dann eine Ausrede vorgeschoben, warum man positiv ist. Aber man weiß es halt auch nicht genau. Es kann sein, dass manche Sportler wirklich unwissentlich positiv waren. Aber sobald das an die Öffentlichkeit kommt, ist der Zug abgefahren. Die Allgemeinheit glaubt einem dann einfach nicht mehr und das ist ein Risiko, dass man als Sportler auch irgendwie eingeht. Es ist schwierig, da man – zum Beispiel als Radsportler – sowieso immer schon irgendwie unter Generalverdacht steht. Und so etwas ist dann meistens das Karriere-Aus.
Lieber Simon Geschke, vielen Dank für das ausführliche Gespräch!
Interview: Johannes K. Staudt
[1] Vgl. Stieglitz, Olaf und Jürgen Martschukat, „Sportgeschichte“, Docupedia-Zeitgeschichte (zuletzt geändert am 08.07.2016), http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.2.659.v2; Guillaume Martin, Socrate à Vélo: Le Tour de France des philosophes (Paris: Grasset, 2020), 30–44.
[2] Berufsradsportler absolvieren bis zu 35.000 km im Jahr auf ihrem Arbeitsgerät.
[3] Das 256 km lange Eintagesrennen Paris – Roubaix gilt als die „Königin der Klassiker“ und ist eines der fünf „Monumente des Radsports“. Es wird seit 1896 ausgetragen und ist geprägt historischen Landstraßen, die in 29 Sektoren über Kopfsteinpflaster von teils napoleonischer Provenienz führen. Dies und die Terminierung Anfang April, die oft starken Wind und Regen begünstigt, tragen dazu bei, dass das Rennen bis heute einen Kosenamen behalten hat, der eigentlich die Verwüstungen verarbeitete, die der Erste Weltkrieg in dieser Landschaft hinterlassen hatte: L’enfer du nord – die Hölle des Nordens. Vgl. Harry Pearson, Quer durch Flandern: Eine knochenschüttelnde Reise durch das Epizentrum der Radsportleidenschaft (Bielefeld: Covadonga, 2021), 270–73.
Die Bezeichnung „Flandrien“ hat sich im Laufe der Zeit von einer Herkunftsbezeichnung für die Flamen im Peloton zu einer ehrerbietenden Charakterisierung für Rennfahrer entwickelt, die sich durch besondere Zähigkeit in vorwiegend flachem Gelände bei widrigen Straßen- und Witterungsbedingungen auszeichnen. Denn durch frühe Erfolge flämischer Fahrer avancierte der Radsport in Flandern zu einem Symbol nationaler Selbstbehauptung gegenüber dem übermächtigen Frankreich. In der Folge schien der Radsport vielen flämischen Jungen aus einfachen Verhältnissen die einzige Möglichkeit zum sozialen Aufstieg zu bieten. Unter den Trainingsbedingungen auf den mit Kopfsteinpflaster befestigten Landstraßen in der flämischen Hügellandschaft entwickelten sich auffällig oft Fahrer, die im Gegensatz zu den populären, leichtgewichtigen Bergspezialisten aus Frankreich und Italien durch Kraft und Unverwüstbarkeit auffielen: „In Flandern musste man auf die Pedale einprügeln. […] Jeder Pedaltritt erschien wie Agonie, doch die [Flandrien] machten weiter, unerbittlich und schmutzig wie der Winterregen. ‚Wenn ich litt, war ich glücklich, denn wenn ich litt, wusste ich, dass alle anderen tot waren‘ sagte Briek Schotte.“ Er siegte unter anderem je zweimal bei der Ronde van Vlaanderen und der Weltmeisterschaft. Pearson, Quer durch Flandern, 30f.
[4] Bis etwa 1920 galt Alkohol ob seiner anregenden Wirkung als grundlegender Bestandteil der Sportnahrung. Für die Fahrer von Alcyon, dem Topteam jener Jahre, ist bei Paris – Bordeaux der Konsum einer Flasche Cognac und mehreren Gläsern Weißwein, Portwein und Champagner überliefert. Vgl. Benjo Maso, Der Schweiß der Götter: Die Geschichte des Radsports (Bielefeld: Covadonga, 2011), 76.
[5] Die UCI WorldTour ist die höchste Rennserie im Radsport. Sie besteht aktuell aus 33 Etappen- und Eintagesrennen rund um die dreiwöchigen Grand Tours (Tour de France, Giro d’Italia & Vuelta a España) und die fünf „Monumente des Radsports“, die traditionsreichsten und herausforderndsten Eintagesrennen (Milano – Sanremo, De Ronde van Vlaanderen, Paris – Roubaix, Liège – Bastogne – Liège & Il Lombardia). Startberechtigt sind 19 WorldTeams, auf Einladung die zweitklassigen ProTeams und die jeweilige Nationalmannschaft des Gastgeberlandes. Vgl. https://www.uci.org/road/events/uci-worldtour.
[6] Jean-Luc Gatellier, „Guillaume-martin-vise-une-victoire-d-etape“, L’Équipe, zuletzt geändert am 30.06.2021, https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Guillaume-martin-vise-une-victoire-d-etape/1265785.
[7] Michael Brandt, „Die Freiburger Universität als Doping-Küche“, Deutschlandfunk Kultur, zuletzt geändert am 02.07.2015, https://www.deutschlandfunkkultur.de/sportmedizin-die-freiburger-universitaet-als-doping-kueche.1001.de.html?dram:article_id=324290.
[8] Vgl. u. a. MPCC, „Cycling more credible than last year?“, zuletzt geändert am 27.01.2021; Johannes Aumüller, „Eine Kontrollinstanz wird abserviert“, Süddeutsche Zeitung, zuletzt geändert am 02.09.2020, https://www.sueddeutsche.de/sport/tour-de-france-radsport-uci-1.5017171-0#seite-2.
[9] Vgl. u. a. N. N., „Blutbeutel werden vernichtet: Dopingarzt Fuentes verurteilt“, F.A.Z., zuletzt geändert am 30.04.2013,https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/doping/dopingarzt-fuentes-verurteilt-blutbeutel-werden-vernichtet-12168085.html; Stéphane Mandard, „Le Real Madrid et le Barça liés au docteur Fuentes“, Le Monde. Zuletzt geändert am 07.12.2006. https://www.lemonde.fr/sport/article/2006/12/07/le-real-madrid-et-le-barca-lies-au-docteur-fuentes_843071_3242.html.
[10] Hajo Seppelt et al, „Schuldig: Wie Sportler ungewollt zu Dopern werden können.“ ARD Sportschau. Zuletzt geändert am 16.07.2021. https://www.ardmediathek.de/video/sportschau/geheimsache-doping-schuldig-wie-sportler-ungewollt-zu-dopern-werden-koennen/das-erste/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWZiNDBjYzRhLTdhMTQtNDE2ZC04NTM0LTYwNGRmOGQzNzlkNQ/.