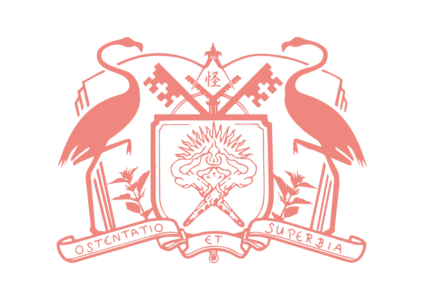Eine Prosastudie
Hannes B. saß seit einundzwanzig Tagen an einem rotbraunen Holzschreibtisch in seiner Wohnung und hatte die Zeit vergessen. Vor ihm lag eine alte Sonntagszeitung, die er die Tage über wieder und wieder gelesen hatte. Er las einen Teil: Politik, Feuilleton, Wirtschaft, und nachdem er einen Teil studiert hatte, legte er ihn auf den Stapel der bereits durchgesehenen Blätter. Wenn er fertig war, glitten seine Hände unbemerkt nach rechts zu dem Stapel von abgelegtem Zeitungspapier, um von vorne zu beginnen. Die Uhr, die hinter ihm an der Wand hing, war am siebzehnten Tag stehen geblieben. Während er blätterte, wobei seine braunen Augen hinter der Hornbrille durch die Zeilen der Zeitung huschten, wurden die Seiten allmählich spröde und das Schwarz der Druckertinte verblasste zu aschfahlem Grau. Die Wände um ihn herum wurden mit seinen Pfeifenzügen fortwährend gelblicher, und mit ihnen auch das Papier seiner Zeitung. Hätte der von seinem Klingelschild als Dr. B. Ausgewiesene über einen Spiegel verfügt, so hätte ihm die wachsende Tiefe seiner schwarzen Augenringe den Lauf der Dinge angezeigt. Doch Hannes konnte nicht sehen, wie müde er war, und vertieft in die vergangenen Ereignisse bemerkte er auch nicht die wenigen, aber doch deutlichen kleinen roten Flecken auf seinen Händen, die sich auf seine Haut legten. Er war krank geworden.
Hätte ihn nicht eines Abends die Nachbarin S. – die, zumindest ihrem Willen nach, an einer anderen Türe hatte klopfen wollen – dazu veranlasst, sich zu erheben, wäre Hannes wohl schließlich einmal vollends erschöpft von seinem Stuhl gerutscht. Als er sich auf das Klopfen der Nachbarin hin erhob, fuhr ihm blitzartig ein ungeheurer Schmerz durch seine Wirbelsäule, sodass er unter der Anstrengung, nicht zu schreien, die Mundwinkel in die Länge zog und angestrengt beide Hände in die Seiten stemmte. Die Frau – oder das Fräulein S., wie Hannes sie im Stillen nannte – war über das hagere, rotgefleckte Erscheinungsbild des Herrn Doktoren noch erstaunter als über ihre Verwechslung der Türe. Verwirrt über ihren Irrtum und den sich ihr nun darbietenden Anblick gab sich das Fräulein S. Mühe, ihre Augen nicht allzu weit aufzureißen. Sie wollte Hannes – so wiederum nannte sie im Stillen Herren B. – ihren Schrecken nicht anmerken lassen. Sie hatte sich weniger im Mann als in der Türe getäuscht.
„Ach“, sagte Frau S., „Sie sind es. Ich wollte ja eigentlich zu Herrn P. Das tut mir leid, ich muss sie wohl aufgeschreckt haben…“
„Wissen Sie, ich war gerade dabei, meine Zeitung zu lesen, Politik, Sie verstehen. Aber ich war wohl allzu vertieft und hätte darüber fast die Erfordernisse des Tages vergessen. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet.“
Hannes rang sich ein Lächeln ab, doch seine Züge waren noch verzerrt vom Schmerz, der durch seinen Rücken gezuckt war, und er fühlte, dass das Kringeln seiner Lippen etwas Steifes hatte. Auch Frau S. rang ihrem Schrecken nur mühsam ein Lächeln ab.
„Nun, wenn das so ist“, sagte sie verlegen, „bin ich beruhigt. Bei all dem Rummel in der Welt kann es einem leicht passieren, dass man die eigenen Sorgen im Leben aus den Augen verliert. Schönen Tag, Herr B.“
Hannes tappte, nachdem er die Türe, die nach innen aufging, langsam geschlossen hatte, zurück in seine Wohnung. Er grübelte über die Entgeisterung, die er unter dem schönen Lächeln des Fräulein S. wahrgenommen zu haben meinte. Dabei fielen ihm die ihn umgebenden Wände auf, die gelbliche Farbe angenommen hatten. Er trat zu der, wie ihm nun auffiel, stehengebliebenen Wanduhr und strich mit seinen Fingern über das staubig gewordene Glas, sah auch die roten Flecken auf seinen Händen und erschrak heftig. In seinem Kopf begannen die Gedanken zu rasen und der Schmerz der bewusstlos durchhungerten Wochen pochte in seinem Magen. Wieder musste Hannes einen Schrei unterdrücken. Zum Zerreißen gespannt, stand Hannes nun da, in ihm der Schrei, der nicht stören sollte.
Hannes blickte auf den gewaltigen Hügel aus verbranntem Pfeifentabak, der sich in einem kristallenen Aschenbecher aufgetürmt hatte. Er wandte sich ab und nahm einen tiefen Zug Atemluft, fühlte den Strom durch seine Nase kühl und frei, und war gewiss, seit Langem nicht so unbeschwert geatmet zu haben. Der, wie Hannes fand, süßliche, kalte Rauch seiner noch warmen Pfeife stand im Raum. Er genoss den Gebrauch seines Geruchsinns, tat noch ein paar weitere kräftige Züge. Indem so das Leben in ihm erwachte, spürte Hannes auch seine Müdigkeit. Er wusste nicht, ob und wie lange er während der letzten Tage geschlafen hatte. Vielleicht war er von Zeit zu Zeit über seiner Zeitung vom Schlaf übermannt worden und hatte den Kopf auf die harte und kühle Oberfläche seines Tisches fallen lassen, doch dann wäre er nach kurzer Zeit wiedererwacht, das wusste er – aus den Träumen gedrängt von seinem Verlangen nach Tabak. Hannes erhob sich und ging hinüber zu seinem Bett. Ohne sich zu entkleiden, ließ er seinen Körper auf die feinsäuberlich gefaltete Decke gleiten. Auf dem Rücken liegend, und in Gedanken der Frage nachgehend, ob er nun endgültig dazu bestimmt sei, wahnsinnig zu werden, schlossen sich Hannes’ Augen und der Schlaf ergriff von ihm Besitz.
Herr B. träumte. Er saß allein in einem dunklen Theater, in erster Reihe. Um seine Ohren strichen kühle Luftzüge. Er blickte sich um, wunderte sich über die dunkle Ereignislosigkeit. Da sah er im Zwielicht, wie jemand an einer großen, altmodischen Maschine einen metallenen Hebel umlegte. Das Knallen des Hebels auf das Blechgehäuse der Maschine hallte durch die leeren Weiten des Theaters, und grelle Lichtkegel trafen in einem gleißenden Fleck über der Bühne zusammen. Geblendet konnte Herr B. vorerst nichts von dem erkennen, was sich dort vor und über ihm abspielte. Er sah lediglich die weinroten Vorhänge, die hinter der Bühne zusammentrafen. So wie sein Blick sich allmählich an das Licht gewöhnte, erkannte er das Fräulein S., das von der Decke herab, an einem Seil, einige Meter über dem Boden schwebte. Das Fräulein war schön, lieblich. Ihr Gesicht strahlte golden im Licht der Scheinwerfer. Sie trug ein weißes Gewand, und goldene Bänder umschlungen die grazilen Rundungen ihres Körpers. Aus ihrem Rücken brachen plötzlich mächtige schwarze Flügel hervor, mit denen sie langsam auf und ab zu schlagen begann, um sich in der Luft zu halten.
Hannes verbrachte drei volle Tage in seinem Bett. Wenn er für kurze Zeit erwachte, befand er sich in Trance. Unter größter Anstrengung taumelte er dann mit einem verstaubten Glas zum Wasserhahn und trank, trank wie ein Verdurstender, bevor er wieder in sein Bett zurückfiel, zurück in tiefsten Schlaf. Am dritten Tag wurde sein Schlaf leichter, er erwachte häufiger, träumte wirre Szenen, doch in wirklicher Erinnerung blieb ihm nur der Traum vom schwarz geflügelten Fräulein S. Sein Magen schrie nach Füllung. Er riss die Türen seiner Küchenschränke auf, fand etwas Essbares, schlang es herunter. Sein Magen war die Kost nicht gewohnt, er sträubte sich. Bald wurde Hannes übel, doch ihn kümmerte es nicht. Er dachte bei sich: Wenn nicht das Fräulein S. gekommen wäre, wenn sie sich nicht in der Türe getäuscht hätte, was wäre aus mir geworden? Kann ich sicher sein, dass ich mich in meinem Wahnsinn nicht zu Tode gehungert hätte? Der Tabak hielt mich bei Bewusstsein, doch wer weiß, wie lange ich noch hätte lesen können, wieder und wieder dasselbe, nichtsahnend von meinem Zustand? Wie kann ein Mensch, der doch immerzu gezwungen ist, seine Zeit mit sich selbst zu teilen, sich so fremd werden, so wach sein, und doch bewusstlos, sich selbst ein solches Martyrium zufügen? Wie kann ich sagen, dass ich mich kenne, wenn ich keinen Schimmer davon habe, was mich in den Wahn dieser Wiederholung trieb? Mich selbst wie sonst niemanden zu kennen, habe ich geglaubt, mit Gewissheit zu wissen, was mich im Innersten zusammenhält. Oft habe ich geglaubt, auch meine Nächsten besser zu kennen als sie sich selbst, doch die vergangenen Tage entzogen meinem Glauben das Fundament. Nichts weiß ich von mir, nichts Wirkliches, als das ich fast wahnsinnig wurde über der Wiederholung des Immergleichen, das immer neu mir schien in meiner Blindheit.
In seiner Verzweiflung griff Hannes zum Hörer seines Telefons. Er rief einen Freund, Maximilian an. Die beiden hatten, seit Maximilian in eine ferne Großstadt gezogen war, nie viel Kontakt gehabt, und wenn es doch einmal zu einem Gespräch gekommen war, so war es stets Maximilian gewesen, der Hannes’ Telefon hatte schrillen lassen.
Hannes wusste nicht, wieso es ausgerechnet Maximilian war, den er anrief. „Hannes? Das gibt es ja nicht, dass du dich nochmal meldest. Wie geht es dir, mein Bester?“ Hannes war zum Zerreißen gespannt, und wünschte sich nichts sehnlicher, als Maximilian von den vergangenen Wochen zu erzählen. „Ja, ich bin es. Heute Morgen habe ich an dich denken müssen, da fiel mir auf, wie lange ich nichts mehr von dir gehört habe. Mir geht es gut, wirklich.“ Es stellte sich heraus, dass Maximilian bald in der Stadt sein würde, und sie vereinbarten ein Treffen.
Das Café war gut besucht, und aus Lautsprechern drangen im Wechsel Musik, Werbeslogans und das Geplapper von Radiomoderatoren. Auf einem Stuhl, Hannes den Rücken zugewandt, saß Maximilian und sah aus dem Fenster. Seinen Mantel, den Hannes sofort erkannte (er musste ihn seit über einem Jahrzehnt besitzen) hatte Maximilian über die Lehne des Stuhls gehängt. Er trug einen weinroten Pullover, und vor ihm lag aufgeschlagen ein dünnes Taschenbuch. Hannes rief Maximilians Namen, doch sein Ruf verhallte zwischen dem lauthalsen Lachen einer Gruppe junger Männer in Anzügen und der Wetteransage des Radios. Erst als er Maximilian auf die Schulter klopfte, wandte dieser den Kopf. Hannes musste lächeln. Auch Maximilian lachte ihn an, erhob sich und umarmte den auf einen Händedruck eingestellten Dr. B.
„Ich konnte nicht glauben, dass du es bist, als ich deine Stimme am Telefon gehört habe.“ Es lag kein Vorwurf in seinen Worten, doch Hannes Blick glitt langsam unter den Tisch. Er dachte angestrengt darüber nach, wie er es schaffen könnte, das Gespräch auf sein Leiden, seinen Wahn zu lenken, ohne dabei zu zeigen, wie dringlich sein Problem war. Sie schwiegen. Hannes fiel kein unauffälliger Weg ein. Er sagte schließlich: „Es geht mir nicht gut im Moment. Du weißt, dass ich mich selten bei dir melde, nicht aus böser Absicht. Ich weiß nicht, wieso ich das tue. Ich wollte dich sprechen, weil ich in den letzten Wochen fast wahnsinnig geworden bin.“ Maximilian sah ihn ruhig aus seinen braunen Augen heraus an, und Hannes erzählt ihm von den vergangenen Wochen.
Nachdem er geendet hatte, schwieg Maximilian für einige Sekunden, dann zeichnete sich, kaum merklich, ein Lächeln auf seinem Gesicht ab. „Seit wann liest du Zeitung?“, fragte er. Hannes verstand nicht. „Was du mir da erzählst, ist doch nichts Neues, lieber Hannes. Schon im Studium saßt du über Tage hinweg nur in deinem Zimmer, hast nichts von dir hören lassen, und dich in deinen Büchern vergraben. Schon damals warst du dünn und bleich. Du hättest es in deiner Kunst, der Wiederholung, endlich zur Meisterschaft gebracht, hätte nicht die Nachbarin dich von der Vollendung deines Werks abgehalten.“ Maximilian sah Hannes fest in die Augen. „Ich bin so müde, seitdem ich nicht mehr Zeitung lese.“, sagte Hannes. Maximilian lächelte ihn an: „Wenn du müde bist, musst du schlafen.“
Hannes nahm sich frei. Er war wegen der roten Punkte zu einem Arzt gegangen. Es wurde ihm eine Salbe verschrieben, die auf der Haut brannte, doch die roten Punkte verschwanden allmählich. Er schlief. Oft lag er stundenlang auf dem Rücken in seinem Bett, wach, und dachte an nichts. Wenn er das Haus verließ, dann meist, um Lebensmittel einzukaufen oder um spazieren zu gehen. Er ging stets dieselbe Route, abends, wenn die Straßen nahezu menschenleer waren. Am liebsten ging er hinaus, wenn es regnete. Ohne Schirm, um die kalten Regentropfen zu spüren. Einmal, als Hannes abends durch die Straßen ging, wobei sein Blick auf den Asphalt gerichtet war, blickte er auf, und erkannte in einiger Entfernung das Fräulein S., das an einer braunen Leine einen Dackel ausführte. Hannes freute sich, doch grüßte nicht. Lediglich ein verlegenes Lächeln konnte er sich abringen.
Hannes erinnerte sich, wie er das Fräulein zum ersten Mal gesehen hatte: Sie war gerade dabei gewesen, ihre Wohnung im höhergelegenen Stockwerk zu beziehen, und trug – er verließ gerade auf dem Weg zu seiner Arbeit das Haus – zwei große Blumentöpfe durch die Stiege. Hannes nahm, im Geiste schon beim Tagesgeschäft, das Fräulein zuerst nur beiläufig zur Kenntnis, bevor ein Blick auf ihr rotes Sommerkleid ihn aus seinem Denken riss und zu einer Begrüßung ermutigte. Man stellte sich vor, freudig, und versprach sich gute Nachbarschaft. Dem Fräulein schienen die Töpfe unter den Armen schwer geworden zu sein, und nachdem sie weiter die Treppen hochgestiegen war, hatte er sich gefragt, ob er nicht seiner überaus galanten, rotgekleideten Nachbarin die Töpfe hätte abnehmen sollen. Im Laufe des Tages dachte Hannes noch einige Male an das Fräulein, malte sich ihr Leben aus: in seiner Vorstellung war sie Linkshänderin, besaß ein Geschäft für fremdsprachige Bücher, trank jeden Morgen schwarzen Tee mit frischer Zitrone und trug ausschließlich rote Kleider, im Winter einen schwarzen Wollmantel darüber.
Zurück in seiner Wohnung saß Hannes im dämmrig-gelben Schein seiner Schreibtischlampe, den Kopf in die weißlichen Handflächen gestützt, und hätte womöglich aufs Neue die Zeit vergessen, wäre sein Blick nicht wie zufällig auf die in Stand gesetzte und nun erneut tickende Wanduhr hinter ihm gefallen. Dann plötzlich sprang er wie von äußeren Mächten ergriffen auf, streckte sich, sodass sein Rücken die übliche Beugung vornüber verließ und seine beiden Schultern nach hinten rückten. Im Treppenhaus stieg er, zwei Stufen in einem Schritt nehmend, sechs Stufen nach oben, stockte dann. Er blieb für eine Weile regungslos stehen, wartete auf eine Beruhigung seines Atems, bevor er die restlichen vierzehn Stufen nahm. Als das Fräulein S. ihre Wohnungstüre öffnete und Hannes erkannte, sah sie weniger verdutzt aus, als er angenommen hatte. Es war das erste Mal, das Hannes an ihre Türe klopfte. „Guten Abend, liebes Fräulein. Ich habe mich nicht, wie sie vielleicht denken mögen, in der Türe geirrt!“