Über Vergangenheit, Zukunft und die gesellschaftliche Bedeutung der Geschichtswissenschaft
Bekanntlich widmete sich die letzte FUNZEL-Ausgabe dem Thema Zukunft. Nun, da diese bereits seit annähernd einem Quartal die Philosophen (jene von der Liebe zur Weisheit Getriebenen ebenso wie jene, denen die Disziplin der Broterwerb ist) mit neuen Denkanstößen beglückt, scheint es angebracht, das Thema Zukunft auch aus einer historischen Perspektive zu betrachten. Was also hat die Geschichte über die Zukunft zu sagen?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst ergründen, in welchem Verhältnis Vergangenheit und Zukunft zueinanderstehen. Im öffentlichen Diskurs unserer Gegenwart stößt man allenthalben auf die gute Absicht, aus der Geschichte lernen zu wollen. Der Volksmund versorgt uns gar mit Binsenweisheiten wie: „Wer aus der Geschichte nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ In den Geschichtswissenschaften werden solche Phrasen bestenfalls belächelt; für Historiker*innen zeugen sie eher davon, dass historische Verhältnisse in überaus naiver Eindeutigkeit konstruiert und auf gegenwärtige Situationen projiziert werden.[i]
Die Historia Magistra Vitae als vormoderner Ballast des öffentlichen Diskurses
Allerdings zeigt sich in diesem populären Verständnis der Geschichte ein Topos, der die Auseinandersetzung der Menschen mit ihrer Vergangenheit seit der Antike prägt: der Topos der Historia Magistra Vitae – der Geschichte als „Lehrmeisterin des Lebens“. In seiner bahnbrechenden Analyse dieser Vorstellung zeigt Reinhart Koselleck zwar, dass sich dieses Denkmuster selbst historisch wandelte, konstatiert aber dennoch, dass es „fast ungebrochen bis in das achtzehnte Jahrhundert [währte]“.[ii] Und obwohl Koselleck – aus guten Gründen einer der bedeutendsten geschichtswissenschaftlichen Theoretiker des 20. Jahrhunderts – dem Topos der Historia Magistra Vitae in der Neuzeit Auflösungserscheinungen attestiert, zeigt sich auch in unseren Tagen noch, dass für viele Menschen Geschichte nicht um ihrer selbst willen, sondern vor allem wegen ihres vermeintlichen Nutzens als Wissensbestand für aktuelle Entscheidungsfindungen von Interesse ist.
In dieser Beobachtung steckt aber nicht nur die Frage, auf welche Weise man richtig aus der Geschichte lernt, sondern sie enthüllt zunächst etwas über das Wesen der Geschichte selbst: dass ebendieses Wesen erst durch das Fortschreiten der Zeit wird. Schiller visualisiert die Geschichte als „unvergängliche Kette, die durch alle Menschengeschlechter sich windet“[iii] – die Kette als Ganzes ist zwar ein festgefügtes Ganzes, doch jedes einzelne ihrer Glieder verändert seine Rolle. Jeder kommende Tag, jedes neue Ereignis, das in der Zukunft liegt, wird mit seinem Eintreten ein neues Glied in der Kette und ihr gegenwärtig neuestes Glied zugleich ein unveränderlicher Teil der Vergangenheit. Was gestern noch Zukunft war, ist heute schon Geschichte.
Dieses Verständnis, dass die Geschichte eine Aneinanderreihung von Zukünften ist, bildet den Kern der Idee von der Historia Magistra Vitae: Wir kennen (scheinbar) die Konsequenzen, die bestimmte Entscheidungen in bestimmten Situationen hatten, und können auf diesen Wissensbestand zurückgreifen, um selbst (hoffentlich) bessere Entscheidungen zu treffen. Ein solcher Ansatz ist schon per se problematisch, weil sein Funktionieren erstens davon abhängt, in welchem Maße die Entscheidungssituationen identisch sind, und zweitens, wie vollständig die Information über den historischen Vergleichsfall ist. Die Charakteristika der Moderne haben seine Anwendbarkeit noch ungleich schwieriger gemacht: Der endgültige Ausbruch aus der abgeschlossenen Weltanschauung der aristotelisch-augustinischen Philosophie durch den Empirismus Francis Bacons, die Aufklärung (besonders die Schottische) und die Innovationskultur, wie sie der Glasgower Maschinenbauer James Watt oder der Freiburger Mathematiker und Ingenieur Thaddäus Rinderle verkörperten, entfesselte ab Mitte des 18. Jahrhunderts eine Dynamik des gesellschaftlichen Wandels, die von einer Reihe aufeinanderfolgender Generationen als Umbruch oder Beschleunigung wahrgenommen wurde.[iv] Die Konsequenzen für das Geschichtsbild waren existenziell, denn mit diesem Prozess veränderte sich die auch die Zeitvorstellung grundsätzlich. Reinhart Koselleck zufolge ist daher das eigentliche Charakteristikum der Moderne nicht etwa eine Zunahme individueller Handlungsmöglichkeiten oder ein technischer Fortschritt, sondern das Auseinanderdriften von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont.[v]
Bis ins 18. Jahrhundert lebten die Menschen in einem relativ statischen Sozialgefüge, das auf einer bäuerlich-handwerklichen, dem Kreislauf der Natur folgenden Welt ruhte. Die Inkubationszeit technischer und sozialer Neuerungen erlaubte, dass „man sich ihnen anpassen [konnte], ohne daß der bisherige Erfahrungshaushalt in Unordnung geraten wäre.“[vi] Über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg begrenzte darüber hinaus die christliche Heilslehre den Erwartungshorizont durch die Vorstellung vom Tag des Jüngsten Gerichts. „Das änderte sich erst mit der Erschließung eines neuen Erwartungshorizonts, durch das, was schließlich als Fortschritt auf den Begriff gebracht worden ist. […] Und was an neuen Erfahrungen seit der Landnahme in Übersee und seit der Entfaltung von Wissenschaft und Technik hinzukam, das reichte nicht mehr hin, um künftige Erwartungen daraus abzuleiten. Der Erfahrungsraum wurde seitdem nicht mehr durch den Erwartungshorizont umschlossen, die Grenzen des Erfahrungsraumes und der Horizont der Erwartung traten auseinander.“[vii] Im Ergebnis wird die Bildung von Erwartungen auf Basis des historischen Erfahrungsrepertoires bestenfalls zum Versuch, sich auf einem unbekannten und im Dunkeln liegenden Terrain mithilfe einer spärlichen Funzel leidlich besser vortasten zu können.
Die andere Perspektivität des Zeitreisenden
Vor diesem Hintergrund wird offenbar, dass seriöse Historiker*innen gar nicht anders können, als einfache Projektionen historischer Begebenheiten auf gegenwärtige und erwartete (vulgo zukünftige) Entwicklungen höchst skeptisch zu betrachten. Erschwerend für jede Form des gegenwartsbezogenen Arbeitens in der Geschichtswissenschaft kommt einerseits hinzu, dass vielen Historiker*innen eine Begründung ihres Studiums einer Epoche in deren Gegenwartsbezug als verengend oder abwertend erscheint, weil sie diskriminierend auf die Faszination für all das wirkt, was keinen unmittelbaren Nutzen für gegenwärtige Fragen zu haben scheint. Und zum anderen läuft man mit der proaktiven Konstruktion historischer Parallelen zu gegenwärtigen Fragen schnell Gefahr, nicht nur inhaltlicher Kritik ausgesetzt zu sein, sondern außerdem in den Verdacht zu geraten, den wissenschaftlichen Objektivitätsanspruch zugunsten einer politischen Agenda zu opfern, und damit die eigene wissenschaftliche Reputation aufs Spiel zu setzen. Dieser Zustand verlangt dringend nach einer kritischen Reflexion, denn im öffentlichen Diskurs um den zukünftigen Kurs der Gesellschaft wird die Verwendung historischer Argumente nicht aufhören. Harvard-Professor David Armitage hat in seinem Vortrag In Defence of Presentism, den er im Dezember 2018 im Westeuropa-Kolloquium des Historischen Seminars in Freiburg hielt, unter anderem auf die Gefahr hingewiesen, dass andere Wissenschaften in dem Maße, in dem sich die Historiker*innen aus öffentlichen und interdisziplinären Diskursen zurückzögen, ein zunehmend ahistorisches Selbstverständnis entwickelten.
Dabei ist es keineswegs so, dass die Historiker*innen sich über Zeitvorstellungen, Zeitrelationen und die Einordnung gegenwärtiger Entwicklungen keine Gedanken machen. Koselleck selbst ist dafür das beste Beispiel. Etwas weniger theoretisch kommen die diesbezüglichen Reflexionen des französischen Historikers Marc Bloch daher, einem Mitbegründer der strukturalistischen Schule der Annales. In seiner Apologie der Geschichtswissenschaft schrieb er, dass es wohl ebenso vergeblich sei, die Vergangenheit ohne die Kenntnis der Gegenwart verstehen zu wollen, wie dies vice versa der Fall sei und illustriert dies mit der – wie ich finde, sehr treffenden – Aussage seines Kollegen Henri Pirenne: „‚Wenn ich Antiquitätenhändler wäre, hätte ich nur Augen für die alten Sachen. Aber ich bin Historiker. Deshalb liebe ich das Leben.‘“[viii] Für Bloch ist eine gegenwartsbezogene vita activa für den Historiker geradezu notwendig, „denn nur hier, in der Gegenwart, kann das pulsierende Leben, das wir unter Aufbietung aller Phantasie den alten Texten einzuhauchen versuchen, von unseren Sinnen unmittelbar wahrgenommen werden.“[ix]
Deutlich wird diese Notwendigkeit, wenn man an Schillers Kettenmetapher zurückdenkt: Für die Geschichtswissenschaft ist nicht nur das Kettenglied als Objekt entscheidend, sondern auch jenes, von dem aus der Historiker sein Objekt in den Fokus nimmt – oder, mit Koselleck gesprochen, die eigene historische Standortgebundenheit.[x] Entscheidend ist, dass sich die Geschichtswissenschaft dabei in erster Linie auf die Erkenntnis der vergangenen Welt, auf die Übersetzung und Erklärung ihrer Begriffe, Denkmuster und Erwartungshorizonte konzentriert, um sie für die Gegenwart fruchtbar zu machen.
„Historians tend to be dedicated, passionate citizens who seek to make a difference by telling true stories. […] They begin their enquiries in a deeply felt present. But as time travellers they have to forsake their own world for a period – and then, somehow, find their way back.”[xi] Die Reflexion der eigenen Standortgebundenheit, wie sie der australische Historiker Tom Griffiths hier vornimmt, zeigt, wie sich Objektivitätsanspruch und das Bewusstsein der eigenen Historizität konstruktiv verbinden lassen. Im Bemühen um eine objektive Erkenntnis der Vergangenheit (das „möglichst“ sei hier immer mitgedacht), muss er eine doppelte Übersetzungsleistung absolvieren: Auf seiner Zeitreise muss er sich bewusst von seinen eigenen Begriffswelten und Denkmustern distanzieren, um frei dafür zu sein, sich möglichst unvoreingenommen auf die Erfahrungsräume, Erwartungshorizonte und Denkmuster einer Vergangenheit einzulassen, sie gedanklich durchdringen und sich aneignen zu können. Auf seinem Weg zurück steht er daraufhin vor der nachfolgenden Herausforderung, die Erscheinungen der erkundeten Welt so gut wie möglich zugänglich zu machen, ihre Begriffshorizonte in unsere gegenwärtigen zu übersetzen.
Die Geschichtswissenschaft hat seit Schillers Zeiten mithilfe ihrer systematischen Methoden enorme Erfolge erzielt. Koselleck qualifiziert sie in der Form, dass wir „mehr über die Vergangenheit der Menschheit insgesamt [wissen], als diese Menschheit in der Vergangenheit je über sich selbst gewußt hat.“[xii] Der fortlaufende, immer neu standortgebundene Übersetzungsprozess aktualisiert und vertieft dieses Wissen nicht nur, er entlastet auch die jeweils alternde Historiographie von der Bürde einer zeitlos-universalen Gültigkeit. Schließlich kann auch sie guten Gewissens darauf vertrauen, beizeiten Gegenstand dieses Übersetzungsprozesses zu werden; das befreit sie selbstredend nicht vom Objektivitätsideal, bewahrt aber vielleicht vor den Fallstricken einer Überabstraktion. In der Gesamtheit entsteht auf diese Weise ein Korpus historiographischer Forschung, der die bewusste Reflexion seiner eigenen Perspektivität (hoffentlich) dazu nutzt, dem Objektivitätsideal besser gerecht zu werden.
Der Zeitreisende als Fremder in der vergehenden Zukunft
Die Wege, die die Historiker*innen als Zeitreisende zurücklegen müssen, sind dabei nicht etwa, wie die Schiller’sche Kette suggeriert, identisch. Der Weg zurück in die Fachöffentlichkeit ist in der Regel kürzer und besser ausgebaut als der Weg in die gesamtgesellschaftlichen Diskurse, die aus bereits verhandelten Gründen bisweilen schmerzhaft lang und unwegsam werden können. In diesem unwegsamen Terrain vorankommen zu können, verlangt eine Reduktion historischer Komplexität, die sich nicht reibungslos in diesen zweiten Übersetzungsprozess einfügt. Ohne die gut ausgebaute begriffliche Infrastruktur der Fachöffentlichkeit, setzt die Beteiligung im öffentlichen Diskurs den Einsatz von leichter zugänglichen Begriffen und Denkmustern voraus, deren rustikalerer Charakter jedoch notwendigerweise viel von der Komplexität verschleißt, die der Historiker sich mühsam erarbeitet hat. Der öffentliche Diskurs zwingt den Zeitreisenden, anstelle der sachlich gebotenen Differenzierung zu vereinfachen und stärkere Werturteile auf einer Basis zu fällen, die sich ihm schwächer als möglich darstellt. Im Schulunterricht, in der Presseöffentlichkeit, in sozialen Medien oder im Bekanntenkreis fühlt er sich gleichsam als Reisender, der der Gesellschaft seiner Gegenwart (Und was ist diese anderes, als die gerade vergehende Zukunft?) durch seine Reise ein Stück weit fremd geworden ist. Und je intensiver er seine Reisen unternimmt, desto schwerer fällt es ihm wohl, diese fremden Welten der Vergangenheit, die er so sehr zu schätzen gelernt hat, in Begriffe und Ideen zu übersetzen, die der Fremdheit dieser Welten nur teilweise gerecht werden können.
Und dennoch ist es dringend notwendig, dass die Historiker*innen diesen für sie beschwerlichen Weg auf sich nehmen – nicht nur, weil sie damit verhindern können, dass bei politischen Entscheidungen, „der Irrtum hinsichtlich der Ursache [eines historisch gewachsenen Zustandes] fast unvermeidlich zur Anwendung eines falschen Therapeutikums führt“,[xiii] wie Bloch am Beispiel der französischen Agrarverfassung zeigt. Es geht noch viel grundsätzlicher darum, einer bewussten Instrumentalisierung historischer Narrative für den politischen Diskurs explizit entgegenzutreten – insbesondere dort, wo diese Instrumentalisierung in besonders aggressiver Weise auch grundlegende historische Fakten und Erkenntnisse negiert, um als Sturmgeschütz gegen eine freiheitlich verfasste Gesellschaft eingesetzt werden zu können. Dies ist nicht nur notwendig, um dem Machthunger potentiell menschenfeindlicher politischer Kräfte explizit entgegenzutreten, sondern letztlich auch für die Verteidigung einer freien Wissenschaft gegen die Gefahr eines Systemwechsels hin zu einer Gesellschaftsordnung, in der am Ende nur noch die Brotgelehrten der Regierung existieren können.
Entsprechend ist dies kein Plädoyer dafür, dass die Geschichtswissenschaft ihre Wissensproduktion an den politischen Bedürfnissen der vergehenden Zukunft ausrichten möge. Dies käme einer Selbstinstrumentalisierung gleich, der auch die aus dem Objektivitätsideal gespeiste Autorität wissenschaftlicher Erkenntnis und Expertise zum Opfer fallen würde. Entscheidend ist vielmehr, dass die Historiker*innen ihre Erkenntnisse selbstbewusst und explizit in den öffentlichen Diskurs einbringen!
Denn allerorten versuchen Akteure in öffentlichen Diskursen, Geschichte im offenen Widerspruch zu historischen Forschungsständen zu instrumentalisieren. Besonders deutlich zeigte sich dies jüngst etwa beim neuen Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig, dessen Konzeption die polnische Regierung nicht am Stand der Wissenschaft sondern am Nationalnarrativ der herrschenden Partei ausrichten ließ, und beim selektiven Rekurs auf historische Mythen in der Kampagne der britischen Brexiteers.[xiv] Im Gegensatz zum doppelten Übersetzungsprozess des Historikers ist das Ziel solcher Akteure nicht die Erschließung vergangener Zeiten für das Erfahrungsrepertoire der Gegenwart. Stattdessen selektieren und präsentieren sie historische Phänomene so, dass sie ihnen als eindeutige historische Narrative zur Verfügung stehen, um ihre Ideologie legitimieren und ihnen gleichsam als „Gift der Nostalgie“ die Zustimmung gesellschaftlicher Gruppen einbringen, die der Zukunft, mit der sie konfrontiert sind, mit Angst oder Skepsis gegenüberstehen.[xv] Um derartigen Instrumentalisierungen entgegenzuwirken, braucht es keine „politische“ Geschichtswissenschaft. Es kommt vielmehr darauf an, dass die Historiker*innen selbstbewusst und proaktiv auch den unwegsamen Teil ihrer Zeitreise auf sich nehmen – den von der Fach- in die allgemeine Öffentlichkeit. Bleibt der Historiker dagegen in der Komfortzone seines Elfenbeinturms, bis seine historisch interessierten Mitmenschen ihn aufsuchen, so „würde [er] allenfalls […] die Bezeichnung ‚nützlicher Antiquar‘ verdienen.“[xvi] Nur, wenn die Historiker*innen als Zeitreisende beständig und vernehmbar ihre Stimme erheben, um die Offenheit und Komplexität historischer Situationen als vergangene Zukünfte zu erklären, können sie ihre Erkenntnisse in den Dienst der in die Zukunft schreitenden Gesellschaft stellen. Denn auf diese Weise tragen sie mit ihren wechselweisen Übersetzungsprozessen einen unersetzlichen und bedeutsamen Teil dazu bei, den einzelnen Menschen und der Gesellschaft als ganzer informierte und differenzierte Diskurse über die Gestaltung ihrer Reise in die Zukunft zu ermöglichen.
[i] Zu diesem aus der Gegenwart konstruierten „Lernen aus der Geschichte“ vgl. exemplarisch die Darstellung Heinrich August Winklers in seinem Vortrag: Aus der Geschichte lernen? Zum Verhältnis von Historie und Politik in Deutschland nach 1945. ZEIT Online. Zuletzt geändert am 25.03.2004. https://www.zeit.de/2004/14/winkler.
[ii] Koselleck, Reinhart: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 10. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2017, S. 39.
[iii] Schiller, Friedrich: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Eine akademische Antrittsrede. Jena: Akademische Buchhandlung, 1789, S. 32.
[iv] Der Übergang vom Mittelalter zu einer kapitalistisch geprägten Moderne in Europa war selbstredend das Produkt einer weit größeren Vielfalt philosophischer, gesellschaftlicher, politischer und technischer Entwicklungen und deren Wechselwirkungen und bietet der Geschichtswissenschaft bis heute ein unerschöpfliches Reservoir an Forschungsgegenständen, Perspektiven und Kontroversen. Einen soliden Einstieg dazu bietet Plumpe, Werner: Das kalte Herz. Kapitalismus: Die Geschichte einer andauernden Revolution. Berlin: Rowohlt, 2019, S. 37 – 162.
[v] Vgl. Koselleck: Vergangene Zukunft, S. 359f.
[vi] Koselleck: Vergangene Zukunft, S. 360.
[vii] Koselleck: Vergangene Zukunft, S. 362/364.
[viii] Pirenne, Henri zit. n. Bloch, Marc: Apologie der Geschichtswissenschaft oder der Beruf des Historikers. Nach der von Étienne Bloch edierten französischen Ausgabe herausgegeben von Peter Schöttler. 3. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta, 2016, S. 50f.
[ix] Bloch, Marc: Apologie der Geschichtswissenschaft oder der Beruf des Historikers, S. 51.
[x] Vgl. Koselleck: Vergangene Zukunft, S. 183 – 188.
[xi] Griffiths, Tom: The Art of Time Travel. Historians and Their Craft. Carlton: Schwartz, 2016, S. 3f.
[xii] Koselleck: Vergangene Zukunft, S. 177.
[xiii] Bloch: Apologie der Geschichtswissenschaft oder der Beruf des Historikers, S. 47.
[xiv] Vgl. hierzu u. a. Adler, Sabine: Erinnerungskultur in Polen. Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Deutschlandfunk. Zuletzt geändert am 05.08.2018. https://www.deutschlandfunk.de/das-museum-des-zweiten-weltkriegs-in-danzig.2016.de.html?dram:article_id=424603. Stach, Stephan: Jede Nation hat eben ihre eigene Wahrheit. Polens Weltkriegsmuseum. F. A. Z. Online. Zuletzt geändert am 23.05.2016. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/polens-regierung-will-das-weltkriegsmuseum-auf-linie-bringen-14247173.html. O’Toole, Fintan: Today Britain Discovers it Cannot Escape History. The Irish Times. Zuletzt geändert am 15.01.2019. https://www.irishtimes.com/opinion/fintan-o-toole-today-britain-discovers-it-cannot-escape-history-1.3757673.
[xv] Schneider, Clemens: Das Gift der Nostalgie. Prometheus. Zuletzt geändert am 06.09.2019. https://prometheusinstitut.de/das-gift-der-nostalgie/?fbclid=IwAR0niV3dTH2M9J_jX5Inh2jzwkF1bMaETTiWvyeaFSFWZnEfELWXnHT6dgc.
[xvi] Bloch: Apologie der Geschichtswissenschaft oder der Beruf des Historikers, S. 52.
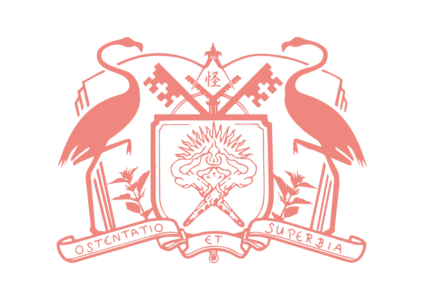
Vielen Dank für diesen inspirierenden Artikel! Besonders gut hat mir die Darstellung der „historischen Standortgebundenheit“ nach Koselleck gefallen, sowie die daraus sich ergebende Rolle des*r Historiker*In als Zeitreisende*r, der*die eine Übersetzungsleistung zwischen unterschiedlichen Welten, zwischen Vergangenheit und Gegenwart vollzieht. Ein Aspekt, der mir als Erweiterung deiner Gedanken spannend erscheint und der mir beim Lesen in den Sinn kam: Der*die Historiker*In sieht sich ja einer Vielfalt von Vergangenheiten gegenüber. Er*sie wählt eine Epoche, ein Narrativ, eine Kultur oder ein Ideensystem, um seinen Fokus zu justieren und aus der Vielfalt des Vergangenen seine Worte, d.h. die von ihm dargestellte Vergangenheit, herauszuarbeiten. Müsste man angesichts der Pluralität der Postmoderne nicht notwendigerweise auch von einer Vielzahl möglicher Gegenwarten sprechen, in die hinein der*die Historiker*In übersetzen kann? Angesichts verschiedener menschlicher Gegenwarten eine kluge und reflektierte Auswahl zu treffen, würde sich demnach als zusätzliche Aufgabe des Übersetzens herausstellen. Ansonsten liefe man m. E. Gefahr, eigene Denkmuster anderen überstülpen zu wollen. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Der Europaunionist liest Geschichte anders als die Europaföderalistin; beide unterscheiden sich nicht nur in ihrer Vorstellung hinsichtlich der Entwicklung Europas, sondern auch in ihrer Denk- und Begriffswelt, in ihrer Sprache, ihrer Interpretation und Anordnung von Fakten. Eine übersetzungssensible Geschichtsschreibung könnte diese Pluralität unterschiedlicher Gegenwarten reflektieren, thematisieren und unterschiedlich berücksichtigen. Dazu könnten unterschiedliche Gegenwarten wahrgenommen und der eigene Gegenwartsfokus deutlich gemacht werden.